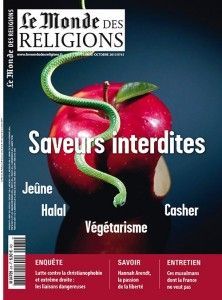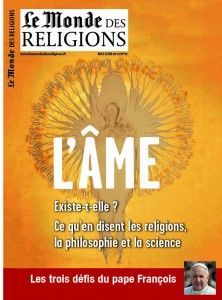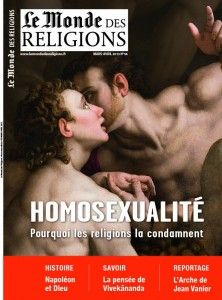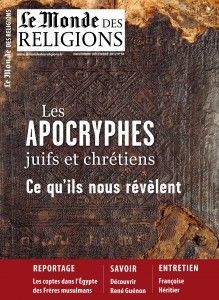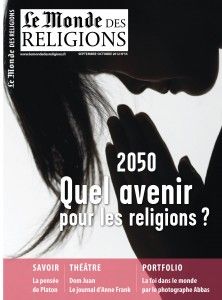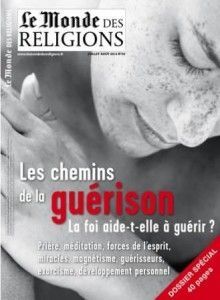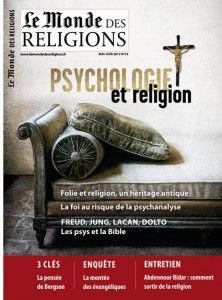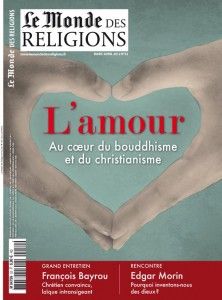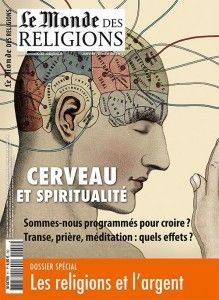Leitartikel Welt der Religionen
In absteigender chronologischer Reihenfolge aufgelistet: vom aktuellsten (Nov.-Dez. 2013) bis zum ältesten (Nov.-Dez. 2004)
Speichern
Speichern
Le Monde des Religions Nr. 62 – Nov./Dezember 2013 – Zum Thema Wunder kenne ich keinen so tiefgründigen und erhellenden Text wie die Betrachtung Spinozas in Kapitel 6 des Theologisch-politischen Traktats. „So wie die Menschen jede Wissenschaft, die den menschlichen Verstand übersteigt, göttlich nennen, sehen sie in jedem Phänomen, dessen Ursache im Allgemeinen unbekannt ist, die Hand Gottes“, schreibt der niederländische Philosoph. Gott kann jedoch nicht außerhalb der von ihm selbst aufgestellten Naturgesetze handeln. Auch wenn es unerklärliche Phänomene gibt, widersprechen sie niemals den Naturgesetzen, sondern erscheinen uns als „wundersam“ oder „erstaunlich“, weil unser Wissen über die komplexen Naturgesetze noch begrenzt ist. Spinoza erklärt daher, dass die in der Heiligen Schrift berichteten Wunder entweder legendär oder das Ergebnis natürlicher Ursachen sind, die unser Verständnis übersteigen: Dies ist der Fall beim Roten Meer, das sich unter der Wirkung eines heftigen Windes geöffnet haben soll, oder bei den Heilungen Jesu, die Kräfte mobilisieren, die dem menschlichen Körper oder Geist noch unbekannt sind. Der Philosoph unternimmt dann eine politische Dekonstruktion des Wunderglaubens und prangert die „Arroganz“ derer an, die damit zeigen wollen, dass ihre Religion oder ihre Nation „Gott lieber ist als alle anderen“. Der Glaube an Wunder, verstanden als übernatürliche Phänomene, erscheint ihm nicht nur als eine „Dummheit“, die der Vernunft widerspricht, sondern auch dem wahren Glauben widerspricht und diesem abträglich wäre: „Wenn also in der Natur ein Phänomen aufträte, das nicht ihren Gesetzen entspricht, müsste man zwangsläufig zugeben, dass es ihnen widerspricht und die Ordnung umkehrt, die Gott im Universum geschaffen hat, indem er ihm allgemeine Gesetze gab, die es ewig regeln. Daraus müssen wir schlussfolgern, dass der Glaube an Wunder zu allgemeinem Zweifel und Atheismus führen sollte.“ Ich schreibe diesen Leitartikel nicht ohne Emotionen, denn es ist mein letzter. Es ist tatsächlich fast zehn Jahre her, dass ich „Le Monde des Religions“ leitete. Es ist an der Zeit, meine Zeit abzugeben und mich ganz meinen persönlichen Projekten zu widmen: Büchern, Theaterstücken und bald, so hoffe ich, einem Film. Ich habe dieses außergewöhnliche redaktionelle Abenteuer mit großer Freude erlebt und danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Treue, die es dieser Zeitung ermöglicht hat, zu einer echten Referenz in religiösen Fragen im gesamten französischsprachigen Raum zu werden (sie wird in sechzehn französischsprachigen Ländern vertrieben). Ich hoffe aufrichtig, dass Sie ihr auch weiterhin verbunden bleiben, und freue mich, die Leitung Virginie Larousse, der Chefredakteurin, anzuvertrauen, die über ausgezeichnete Kenntnisse der Religionen und gute journalistische Erfahrung verfügt. Sie wird bei ihrer Aufgabe von einem Redaktionskomitee unterstützt, das sich aus mehreren Ihnen bekannten Persönlichkeiten zusammensetzt. Wir arbeiten gemeinsam an einer neuen Formel, die Sie im Januar entdecken werden und die sie Ihnen in der nächsten Ausgabe selbst vorstellen wird. Herzliche Grüße an alle. Lesen Sie die Artikel von Le Monde des Religions online: www.lemondedesreligions.fr Speichern Speichern Speichern Speichern [...]
Le Monde des Religions Nr. 61 – Sept./Oktober 2013 – Wie der heilige Augustinus in „Das glückliche Leben“ schrieb: „Der Wunsch nach Glück ist dem Menschen wesentlich; er ist der Beweggrund all unseres Handelns. Das Ehrwürdigste, Verstandenste, Klarste und Beständigste auf der Welt ist nicht nur, dass wir glücklich sein wollen, sondern dass wir nichts anderes sein wollen. Dazu zwingt uns unsere Natur.“ Wenn jeder Mensch nach Glück strebt, stellt sich die Frage, ob tiefes und dauerhaftes Glück hier auf Erden existieren kann. Die Religionen liefern zu diesem Thema sehr unterschiedliche Antworten. Die beiden gegensätzlichsten Positionen scheinen mir die des Buddhismus und des Christentums zu sein. Während die gesamte Lehre Buddhas auf dem Streben nach einem Zustand vollkommener Gelassenheit hier und jetzt beruht, verspricht die Lehre Christi den Gläubigen wahres Glück im Jenseits. Dies liegt am Leben ihres Gründers – Jesus starb mit etwa 36 Jahren auf tragische Weise –, aber auch an seiner Botschaft: Das von ihm verkündete Reich Gottes war kein irdisches, sondern ein himmlisches, und die Seligkeit sollte kommen: „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden“ (Matthäus 5,5). In einer antiken Welt, die – auch im Judentum – eher dazu neigte, das Glück hier und jetzt zu suchen, verlagerte Jesus die Frage des Glücks eindeutig ins Jenseits. Diese Hoffnung auf ein himmlisches Paradies zog sich durch die Geschichte des christlichen Westens und führte mitunter zu zahlreichen Extremismen: radikaler Askese und dem Wunsch nach Martyrium, Kasteiungen und Leiden im Hinblick auf das himmlische Reich. Doch mit Voltaires berühmten Worten – „Das Paradies ist, wo ich bin“ – vollzog sich ab dem 18. Jahrhundert in Europa eine gewaltige Umkehr der Perspektive: Das Paradies war nicht mehr im Jenseits zu erwarten, sondern konnte dank Vernunft und menschlicher Anstrengung auf Erden erreicht werden. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod – und damit an ein Paradies im Himmel – wird allmählich schwinden, und die große Mehrheit unserer Zeitgenossen wird das Glück im Hier und Jetzt suchen. Die christliche Predigt wird völlig erschüttert. Nachdem katholische und protestantische Prediger einst so sehr auf die Qualen der Hölle und die Freuden des Himmels hingewiesen hatten, sprechen sie kaum noch vom Leben nach dem Tod. Die gängigsten christlichen Bewegungen – die Evangelikalen und die Charismatiker – haben diese neue Situation vollständig integriert und bekräftigen stets, dass der Glaube an Jesus das größte Glück bringt, auch hier auf Erden. Und da viele unserer Zeitgenossen Glück mit Reichtum gleichsetzen, gehen manche sogar so weit, den Gläubigen dank des Glaubens „wirtschaftlichen Wohlstand“ auf Erden zu versprechen. Wir sind weit entfernt von Jesus, der sagte: „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt“ (Matthäus 19,24)! Die tiefe Wahrheit des Christentums liegt zweifellos zwischen diesen beiden Extremen: der Lebensverweigerung und der krankhaften Askese – die Nietzsche zu Recht anprangerte – im Namen des ewigen Lebens oder aus Angst vor der Hölle auf der einen Seite; dem alleinigen Streben nach irdischem Glück auf der anderen. Jesus verachtete im Grunde seines Herzens die Freuden dieses Lebens nicht und übte keine „Kasteiung“: Er liebte es zu trinken, zu essen und mit seinen Freunden zu teilen. Wir sehen ihn oft „vor Freude hüpfen“. Aber er bekräftigte klar, dass höchste Seligkeit in diesem Leben nicht zu erwarten ist. Er lehnt irdisches Glück nicht ab, stellt aber andere Werte davor: Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit. Er zeigt damit, dass man sein Glück hier auf Erden opfern und sein Leben für die Liebe, den Kampf gegen Ungerechtigkeit oder die Treue zur Wahrheit hingeben kann. Die zeitgenössischen Zeugnisse von Gandhi, Martin Luther King oder Nelson Mandela sind wunderbare Beispiele dafür. Bleibt die Frage, ob die Hingabe ihres Lebens im Jenseits eine gerechte Belohnung finden wird. Dies ist das Versprechen Christi und die Hoffnung von Milliarden Gläubigen auf der ganzen Welt. Lesen Sie die Artikel online in Le Monde des Religions: www.lemondedesreligions.fr [...]
Le Monde des Religions Nr. 60 – Juli/August 2013 – Eine jüdische Geschichte besagt, dass Gott Eva in Wirklichkeit vor Adam schuf. Da Eva sich im Paradies langweilte, bat sie Gott um einen Gefährten. Nach reiflicher Überlegung gewährte Gott ihr schließlich: „Gut, ich werde den Mann erschaffen. Aber sei vorsichtig, er ist sehr empfindlich: Sag ihm nie, dass du vor ihm erschaffen wurdest, er würde es sehr übel nehmen. Lass das ein Geheimnis unter uns bleiben … unter Frauen!“ Wenn Gott existiert, ist es offensichtlich, dass er kein Geschlecht hat. Wir könnten uns daher fragen, warum die meisten großen Religionen ihn ausschließlich männlich darstellen. Wie uns das Dossier dieser Ausgabe in Erinnerung ruft, war dies nicht immer der Fall. Der Kult der Großen Göttin ging zweifellos dem des „Jahwe, des Herrn der Heerscharen“ voraus, und Göttinnen nahmen in den Pantheons der ersten Zivilisationen einen herausragenden Platz ein. Die Maskulinisierung des Klerus ist zweifellos einer der Hauptgründe für diesen Umbruch, der sich in den drei Jahrtausenden vor unserer Zeitrechnung vollzog: Wie könnten eine von Männern regierte Stadt und Religion eine höchste Gottheit des anderen Geschlechts verehren? Mit der Entwicklung patriarchalischer Gesellschaften wird die Ursache verständlich: Der höchste oder einzige Gott kann nicht länger als weiblich gedacht werden. Nicht nur in seiner Darstellung, sondern auch in seinem Charakter und seiner Funktion: Seine Eigenschaften wie Macht, Herrschaft und Autorität werden geschätzt. Im Himmel wie auf Erden wird die Welt von einem dominanten Mann regiert. Auch wenn der weibliche Charakter des Göttlichen in verschiedenen mystischen oder esoterischen Strömungen innerhalb der Religionen fortbesteht, wird diese Hypermaskulinisierung Gottes letztlich erst in der Neuzeit wirklich in Frage gestellt. Nicht, dass wir uns von einer männlichen zu einer weiblichen Darstellung des Göttlichen bewegen. Wir sind vielmehr Zeugen einer Neuausrichtung. Gott wird nicht mehr in erster Linie als furchterregender Richter wahrgenommen, sondern vor allem als gut und barmherzig; Immer mehr Gläubige glauben an seine gütige Vorsehung. Man könnte sagen, dass die typisch „väterliche“ Figur Gottes zugunsten einer eher typisch „mütterlichen“ Darstellung zu verschwinden scheint. Ebenso werden Sensibilität, Emotion und Zerbrechlichkeit in der spirituellen Erfahrung geschätzt. Diese Entwicklung steht offensichtlich im Zusammenhang mit der Aufwertung der Frau in unseren modernen Gesellschaften, die sich zunehmend auch auf die Religionen auswirkt, insbesondere indem Frauen Zugang zu Lehr- und Leitungspositionen im Gottesdienst erhalten. Sie spiegelt auch die Anerkennung von Eigenschaften und Werten wider, die in unseren modernen Gesellschaften als „typisch“ weiblich gelten, auch wenn sie offensichtlich Männer ebenso betreffen wie Frauen: Mitgefühl, Offenheit, Akzeptanz und der Schutz des Lebens. Angesichts des besorgniserregenden Aufschwungs religiöser Fundamentalismen aller Couleur bin ich überzeugt, dass diese Aufwertung der Frau und diese Feminisierung des Göttlichen den Schlüssel zu einer wahren spirituellen Erneuerung in den Religionen darstellen. Frauen sind zweifellos die Zukunft Gottes. Ich nutze diesen Leitartikel, um zwei Frauen zu würdigen, die unsere treuen Leser gut kennen. Jennifer Schwarz, die Chefredakteurin Ihrer Zeitschrift, verlässt heute ihr Amt, um neue Herausforderungen zu meistern. Ich danke ihr von ganzem Herzen für die Begeisterung und Großzügigkeit, mit der sie sich über fünf Jahre lang in dieser Funktion engagiert hat. Ich begrüße auch herzlich ihre Nachfolgerin in dieser Position: Virginie Larousse. Sie war lange Zeit Herausgeberin einer wissenschaftlichen Zeitschrift für Religionen und lehrte Religionsgeschichte an der Universität Burgund. Sie arbeitet seit vielen Jahren mit Le Monde des Religions zusammen. [...]
Le Monde des Religions Nr. 59 – Mai/Juni 2013 – Als ich gebeten wurde, das Ereignis live auf France 2 zu kommentieren, und erfuhr, dass der neue Papst Jorge Mario Bergoglio hieß, war meine unmittelbare Reaktion, dass es sich um ein wahrhaft spirituelles Ereignis handelte. Das erste Mal hatte ich vor etwa zehn Jahren von Abbé Pierre vom Erzbischof von Buenos Aires gehört. Während einer Reise nach Argentinien war er beeindruckt von der Einfachheit dieses Jesuiten, der den prächtigen Bischofspalast verlassen hatte, um in einer bescheidenen Wohnung zu leben, und der häufig allein in die Elendsviertel zog. Die Wahl des Namens Franziskus, eine Anspielung auf den Poverello von Assisi, bestätigte nur, dass wir im Begriff waren, Zeugen eines tiefgreifenden Wandels in der katholischen Kirche zu werden. Kein Wandel in der Lehre und wahrscheinlich auch nicht in der Moral, sondern in der Konzeption des Papsttums selbst und in der Art und Weise, wie die Kirche geführt wird. Indem er sich den Tausenden von Gläubigen auf dem Petersplatz als „Bischof von Rom“ vorstellte und die Menge bat, für ihn zu beten, bevor sie mit ihnen betete, zeigte Franziskus in wenigen Minuten durch zahlreiche Zeichen, dass er zu einem demütigen Verständnis seiner Rolle zurückkehren will. Ein Verständnis, das an das der ersten Christen erinnert, die den Bischof von Rom noch nicht nicht nur zum Oberhaupt der gesamten Christenheit, sondern auch zu einem wahren Monarchen an der Spitze eines weltlichen Staates gemacht hatten. Seit seiner Wahl hat Franziskus seine karitativen Taten vervielfacht. Nun stellt sich die Frage, wie weit er bei dem immensen Projekt der Erneuerung der Kirche gehen wird, das vor ihm liegt. Wird er die römische Kurie und die Vatikanbank, die seit über 30 Jahren von Skandalen erschüttert sind, endlich reformieren? Wird er eine kollegiale Regierungsform der Kirche einführen? Wird er versuchen, den gegenwärtigen Status des Vatikanstaates beizubehalten, ein Erbe des alten Kirchenstaates, das in eklatantem Widerspruch zu Jesu Zeugnis der Armut und seiner Ablehnung weltlicher Macht steht? Wie wird er sich auch den Herausforderungen der Ökumene und des interreligiösen Dialogs stellen, Themen, die ihn sehr interessieren? Und auch der Evangelisierung in einer Welt, in der die Kluft zwischen kirchlichem Diskurs und dem Leben der Menschen, insbesondere im Westen, immer größer wird? Eines ist sicher: Franziskus besitzt das nötige Herz, die Intelligenz und sogar das Charisma, um diesen großen Atem des Evangeliums in die katholische Welt und darüber hinaus zu tragen, wie seine ersten Erklärungen für einen Weltfrieden auf der Grundlage des Respekts für die Vielfalt der Kulturen und sogar der gesamten Schöpfung zeigen (zum ersten Mal haben die Tiere zweifellos einen Papst, der sich um sie kümmert!). Die heftige Kritik, der er am Tag nach seiner Wahl ausgesetzt war und die ihm als junger Jesuitenoberer geheime Absprachen mit der ehemaligen Militärjunta vorwarf, hörte wenige Tage später auf, insbesondere nachdem sein Landsmann und Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel – 14 Monate lang inhaftiert und von der Militärjunta gefoltert – versicherte, der neue Papst habe im Gegensatz zu anderen Geistlichen „keine Verbindung zur Diktatur“. Franziskus genießt also einen Gnadenstand, der ihn zu jeder Kühnheit verleiten kann. Unter der Bedingung allerdings, dass ihn nicht dasselbe Schicksal ereilt wie Johannes Paul I., der so viel Hoffnung geweckt hatte, bevor er weniger als einen Monat nach seiner Wahl auf rätselhafte Weise starb. Franziskus tut zweifellos nicht Unrecht, wenn er die Gläubigen bittet, für ihn zu beten. www.lemondedesreligions.fr [...]
Le Monde des Religion Nr. 58 – März/April 2013 – Es mag einigen unserer Leser seltsam erscheinen, dass wir nach der hitzigen Parlamentsdebatte in Frankreich über die gleichgeschlechtliche Ehe einen großen Teil dieser Ausgabe der Sicht der Religionen auf Homosexualität widmen. Die wesentlichen Elemente dieser Debatte, die auch die Frage der Abstammung berührt, behandeln wir zwar im zweiten Teil der Ausgabe mit den widersprüchlichen Standpunkten des französischen Oberrabbiners Gilles Bernheim, der Philosophen Olivier Abel und Thibaud Collin, der Psychoanalytikerin und Ethnologin Geneviève Delaisi de Parseval und der Soziologin Danièle Hervieu-Léger. Doch scheint mir eine wichtige Frage bisher weitgehend übersehen worden zu sein: Wie denken Religionen über Homosexualität und wie behandeln sie Homosexuelle seit Jahrhunderten? Diese Frage wurde von den meisten religiösen Führern selbst umgangen, die die Debatte sofort auf das Terrain der Anthropologie und Psychoanalyse verlagerten und nicht auf das der Theologie oder des religiösen Rechts. Die Gründe dafür werden besser verständlich, wenn man sich genauer ansieht, wie Homosexualität in den meisten heiligen Texten heftig kritisiert wird und wie Homosexuelle in vielen Teilen der Welt im Namen der Religion noch immer behandelt werden. Denn während Homosexualität in der Antike weitgehend toleriert wurde, wird sie in den jüdischen, christlichen und muslimischen Schriften als schwerwiegende Perversion dargestellt. „Wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, ist das, was sie tun, ein Gräuel; sie sollen getötet werden, und ihr Blut sei auf ihnen“, heißt es im Buch Levitikus (Lev 20,13). Die Mischna sagt nichts anderes, und die Kirchenväter finden keine harten Worte für diese Praxis, die nach den Worten von Thomas von Aquin „Gott beleidigt“, da sie in seinen Augen die vom Allmächtigen gewollte Ordnung der Natur verletzt. Unter der Herrschaft der sehr christlichen Kaiser Theodosius oder Justinian waren Homosexuelle mit dem Tode bedroht, da sie verdächtigt wurden, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, und für Naturkatastrophen oder Epidemien verantwortlich gemacht wurden. Der Koran verurteilt in etwa dreißig Versen diese „unnatürliche“ und „empörende“ Tat, und die Scharia verurteilt homosexuelle Männer noch immer zu Strafen, die je nach Land variieren und von Gefängnis bis zum Strang, einschließlich hundert Stockschlägen, reichen. Asiatische Religionen sind im Allgemeinen toleranter gegenüber Homosexualität, aber sie wird vom Vinaya, dem Mönchskodex buddhistischer Gemeinschaften, und bestimmten Zweigen des Hinduismus verurteilt. Auch wenn sich die Positionen jüdischer und christlicher Institutionen in den letzten Jahrzehnten deutlich gemildert haben, bleibt die Tatsache bestehen, dass Homosexualität in etwa hundert Ländern immer noch als Verbrechen oder Vergehen gilt und eine der Hauptursachen für Selbstmord unter jungen Menschen ist (in Frankreich hat jeder dritte Homosexuelle unter 20 Jahren aufgrund sozialer Ablehnung einen Selbstmordversuch unternommen). An diese gewalttätige Diskriminierung, die seit Jahrtausenden durch religiöse Argumente getragen wird, wollten wir auch erinnern. Es bleibt die komplexe und grundlegende Debatte, nicht nur über die Ehe, sondern vor allem über die Familie (da nicht die Frage der gleichen Bürgerrechte für homo- und heterosexuelle Paare, sondern die der Abstammung und Fragen der Bioethik im Mittelpunkt steht). Diese Debatte geht über die Forderungen homosexueller Paare hinaus, da sie Themen wie Adoption, medizinisch unterstützte Fortpflanzung und Leihmutterschaft betrifft, die heterosexuelle Paare ebenso betreffen können. Die Regierung war klug genug, sie auf den Herbst zu verschieben und die Meinung des Nationalen Ethikkomitees einzuholen. Dies sind entscheidende Fragen, die weder vermieden noch mit so vereinfachenden Argumenten wie „Das bringt unsere Gesellschaften aus dem Gleichgewicht“ – sie sind tatsächlich bereits aus dem Gleichgewicht – oder im Gegenteil „Das ist der unvermeidliche Lauf der Welt“ gelöst werden können: Jede Veränderung muss im Hinblick darauf bewertet werden, was für Mensch und Gesellschaft gut ist. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/58/ [...]
Le Monde des Religions Nr. 57 – Januar/Februar 2013 – Ist die Vorstellung, dass jeder Mensch seinen eigenen spirituellen Weg finden kann, überaus modern? Ja und nein. Im Osten gab es zur Zeit Buddhas viele Menschen, die nach dem Absoluten suchten und einen persönlichen Weg zur Befreiung suchten. Im antiken Griechenland und Rom boten Mysterienkulte und zahlreiche philosophische Schulen – von den Pythagoräern über die Stoiker und Epikureer bis zu den Neuplatonikern – Menschen auf der Suche nach einem guten Leben zahlreiche Wege der Initiation und Weisheit. Die spätere Entwicklung großer Zivilisationen, die jeweils auf einer Religion basierten, die dem individuellen und kollektiven Leben Sinn gab, schränkte das spirituelle Angebot ein. Dennoch finden sich innerhalb jeder großen Tradition stets unterschiedliche spirituelle Strömungen, die auf eine gewisse Vielfalt individueller Erwartungen reagierten. So bieten die vielen Orden im Christentum eine recht große Bandbreite spiritueller Empfindungen: von den kontemplativsten wie den Kartäuser- oder Karmeliterorden bis zu den intellektuellsten wie den Dominikanern oder Jesuiten, oder auch solchen, die Wert auf Armut (Franziskaner), ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Gebet (Benediktiner) oder karitatives Handeln (Brüder und Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul, Missionare der Nächstenliebe) legen. Über das religiöse Leben hinaus konnten wir seit dem ausgehenden Mittelalter die Entwicklung von Laienvereinigungen beobachten, die meist in der Bewegung der großen Orden lebten, auch wenn diese von der Institution nicht immer gut aufgenommen wurden, wie die Verfolgung zeigt, der die Beginen zum Opfer fielen. Dasselbe Phänomen finden wir im Islam mit der Entstehung zahlreicher Sufi-Bruderschaften, von denen einige ebenfalls verfolgt wurden. Die jüdische mystische Sensibilität wird in der Entstehung der kabbalistischen Bewegung zum Ausdruck kommen, und wir werden in Asien weiterhin eine große Vielfalt an Schulen und spirituellen Strömungen vorfinden. Die Moderne wird zwei neue Elemente mit sich bringen: die Abkehr von der kollektiven Religion und die Vermischung der Kulturen. Wir werden somit Zeuge neuer spiritueller Synkretismen, die mit den persönlichen Sehnsüchten jedes Einzelnen auf der Suche nach Sinn verbunden sind, und der Entwicklung einer säkularen Spiritualität, die sich jenseits jeglicher religiöser Überzeugungen und Praktiken ausdrückt. Diese Situation ist nicht völlig beispiellos, denn sie erinnert an die der römischen Antike. Doch die Vermischung der Kulturen ist viel intensiver (jeder hat heute Zugang zum gesamten spirituellen Erbe der Menschheit), und wir erleben auch eine echte Demokratisierung der spirituellen Suche, die nicht mehr nur eine gesellschaftliche Elite betrifft. Doch trotz all dieser Metamorphosen bleibt eine wesentliche Frage: Sollte jeder Einzelne den spirituellen Weg suchen und kann er ihn finden, der ihm die größtmögliche Erfüllung ermöglicht? Meine Antwort ist klar: Ja. Gestern wie heute ist der spirituelle Weg das Ergebnis einer persönlichen Herangehensweise, und diese hat bessere Erfolgsaussichten, wenn jeder Mensch einen Weg sucht, der seiner Sensibilität, seinen Möglichkeiten, seinem Ehrgeiz, seinen Wünschen und seinen Fragen entspricht. Natürlich gibt es Menschen, die angesichts der großen Auswahl an Wegen, die uns heute geboten werden, verloren sind. „Was ist der beste spirituelle Weg?“, wurde der Dalai Lama einmal gefragt. Die Antwort des tibetischen Führers: „Der, der dich besser macht.“ Dies ist zweifellos ein hervorragendes Kriterium zur Unterscheidung. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2013/57/ Speichern [...]
Le Monde des religions Nr. 56 – Nov./Dez. 2012 – Es gibt Menschen, die verrückt nach Gott sind. Menschen, die im Namen ihrer Religion töten. Von Moses, der das Massaker an den Kanaanitern befahl, bis zu den Dschihadisten von Al-Qaida, einschließlich des katholischen Großinquisitors, nimmt religiöser Fanatismus innerhalb monotheistischer Religionen verschiedene Formen an, entspringt aber immer demselben Schmelztiegel der Identität: Wir töten – oder befehlen das Töten –, um die Reinheit des Blutes oder des Glaubens zu schützen, um die Gemeinschaft (oder sogar eine Kultur, wie im Fall Breschnews) gegen diejenigen zu verteidigen, die sie bedrohen, um den Einfluss der Religion auf die Gesellschaft auszuweiten. Religiöser Fanatismus ist eine dramatische Abweichung von der Botschaft der Bibel und des Korans, deren Hauptziel es ist, Menschen zu Respekt vor anderen zu erziehen. Das ist das Gift des Kommunitarismus: Das Gefühl der Zugehörigkeit – zum Volk, zur Institution, zur Gemeinschaft – wird wichtiger als die Botschaft selbst, und „Gott“ ist nichts weiter als ein Alibi für Selbstverteidigung und Herrschaft. Religiöser Fanatismus wurde vor über zwei Jahrhunderten von den Philosophen der Aufklärung perfekt analysiert und angeprangert. Sie kämpften dafür, dass Gewissens- und Meinungsfreiheit in Gesellschaften bestehen konnten, die noch immer von Religion dominiert waren. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir im Westen heute nicht nur frei sind zu glauben oder nicht zu glauben, sondern auch Religion zu kritisieren und ihre Gefahren anzuprangern. Doch dieser Kampf und diese hart erkämpfte Freiheit dürfen uns nicht vergessen lassen, dass es eben diesen Philosophen darum ging, allen ein harmonisches Leben im selben politischen Raum zu ermöglichen. Meinungsfreiheit, ob intellektuell oder künstlerisch, zielt daher nicht darauf ab, andere anzugreifen, um Konflikte zu provozieren oder auszulösen. Darüber hinaus war John Locke der Ansicht, dass im Namen des sozialen Friedens den hartnäckigsten Atheisten ebenso wie den unnachgiebigsten Katholiken das öffentliche Reden verboten werden sollte! Was würde er heute denen sagen, die einen künstlerisch erbärmlichen Film produzieren und im Internet verbreiten, der das Heiligste für muslimische Gläubige – die Figur des Propheten – berührt, mit dem einzigen Ziel, Spannungen zwischen dem Westen und der islamischen Welt zu schüren? Was würde er denen sagen, die diesen Konflikt noch verschlimmern, indem sie neue Mohammed-Karikaturen veröffentlichen, um Zeitungen zu verkaufen und die noch immer glühende Glut des Zorns vieler Muslime weltweit anzufachen? Und all das mit dem Ergebnis? Todesfälle, die zunehmende Bedrohung christlicher Minderheiten in muslimischen Ländern, zunehmende Spannungen in der ganzen Welt. Der Kampf um die Meinungsfreiheit – so edel er auch sein mag – befreit uns nicht von einer geopolitischen Analyse der Lage: Extremistische Gruppen instrumentalisieren Bilder, um die Massen für einen gemeinsamen Feind zu scharen, einen phantasierten Westen, der auf ein filmisches Delirium und ein paar Karikaturen reduziert ist. Wir leben in einer vernetzten Welt, die zahlreichen Spannungen ausgesetzt ist, die den Weltfrieden bedrohen. Was die Philosophen der Aufklärung auf nationaler Ebene vertraten, gilt heute auf globaler Ebene: Karikaturenkritik, deren einziger Zweck darin besteht, Gläubige zu beleidigen und die Extremisten unter ihnen zu provozieren, ist dumm und gefährlich. Ihre Hauptwirkung besteht darin, das Lager der Gottliebenden zu stärken und die Bemühungen derer zu schwächen, die einen konstruktiven Dialog zwischen Kulturen und Religionen anstreben. Freiheit setzt Verantwortung und Sorge für das Gemeinwohl voraus. Ohne sie ist keine Gesellschaft lebensfähig. http://www.lemondedesreligions.fr/mensuel/2012/56/ Speichern [...]
Le Monde des religions Nr. 55 – September/Oktober 2012 — Vor etwa dreißig Jahren, als ich mein Studium der Soziologie und Religionsgeschichte begann, sprachen wir nur von „Säkularisierung“, und die meisten Religionswissenschaftler gingen davon aus, dass sich die Religion in den zunehmend von Materialismus und Individualismus geprägten europäischen Gesellschaften allmählich wandeln und schließlich auflösen würde. Das europäische Modell würde sich dann mit der Globalisierung westlicher Werte und Lebensstile auf den Rest der Welt ausbreiten. Kurz gesagt: Religion war mehr oder weniger langfristig dem Untergang geweiht. In den letzten zehn Jahren haben sich Modell und Analyse umgekehrt: Wir sprechen von „Entsäkularisierung“, wir erleben überall den Aufstieg identitätsbasierter und konservativer religiöser Bewegungen, und Peter Berger, der große amerikanische Religionssoziologe, stellt fest, dass „die Welt noch immer so stark religiös ist wie eh und je“. Europa wird daher als globale Ausnahme wahrgenommen, die wiederum Gefahr läuft, zunehmend von dieser neuen religiösen Welle erfasst zu werden. Wie also sieht die Zukunft aus? Auf der Grundlage aktueller Trends zeichnen informierte Beobachter im Hauptbericht dieser Ausgabe ein mögliches Panorama der Religionen in der Welt bis 2050. Das Christentum würde seinen Vorsprung gegenüber anderen Religionen ausbauen, insbesondere dank der demografischen Entwicklung der Länder des Südens, aber auch aufgrund des starken Wachstums der Evangelikalen und Pfingstler auf den fünf Kontinenten. Der Islam würde im Laufe seiner demografischen Entwicklung weiter voranschreiten, doch dürfte sich dieses Wachstum deutlich verlangsamen, insbesondere in Europa und Asien, was letztlich das Wachstum des Islams bremsen würde, der weit weniger Konvertiten anzieht als das Christentum. Hinduismus und Buddhismus würden mehr oder weniger stabil bleiben, auch wenn sich die Werte und bestimmte Praktiken des Buddhismus (wie die Meditation) im Westen und in Lateinamerika weiterhin immer weiter verbreiten würden. Wie andere Religionen, die stark in der Minderheit sind und an die Übertragung durch Blut gebunden sind, wird das Judentum je nach demografischen Szenarien und der Anzahl der Mischehen stabil bleiben oder schrumpfen. Doch jenseits dieser großen Trends werden sich die Religionen, wie Jean-Paul Willaime und Raphaël Liogier uns jeweils auf ihre Weise in Erinnerung rufen, weiter wandeln und den Auswirkungen der Moderne, insbesondere der Individualisierung und Globalisierung, ausgesetzt sein. Heute haben Individuen eine zunehmend persönliche Vision von Religion und schaffen ihr eigenes, manchmal synkretistisches, oft improvisiertes Sinnsystem. Selbst fundamentalistische oder integralistische Bewegungen sind das Produkt von Einzelpersonen oder Gruppen, die daran herumbasteln, eine „reine Religion der Ursprünge“ neu zu erfinden. Solange der Globalisierungsprozess anhält, werden Religionen weiterhin Identitätsmerkmale für Menschen liefern, denen diese fehlen und die sich besorgt fühlen oder sich kulturell überfallen oder dominiert fühlen. Und solange der Mensch auf der Suche nach Sinn ist, wird er weiterhin Antworten im riesigen religiösen Erbe der Menschheit suchen. Doch diese Suche nach Identität und Spiritualität kann nicht mehr wie in der Vergangenheit innerhalb einer unveränderlichen Tradition oder eines normativen institutionellen Systems gelebt werden. Die Zukunft der Religionen wird daher nicht nur von der Zahl ihrer Anhänger bestimmt, sondern auch von der Art und Weise, wie sie das Erbe der Vergangenheit neu interpretieren. Und genau das ist das größte Fragezeichen, das jede langfristige Zukunftsanalyse so gefährlich macht. Mangels Rationalität können wir uns also immer etwas vorstellen und träumen. Genau das bieten wir Ihnen in dieser Ausgabe durch unsere Kolumnisten, die sich bereit erklärt haben, die Frage zu beantworten: „Von welcher Religion träumen Sie im Jahr 2050?“ [...]
Die Welt der Religionen Nr. 54 – Juli/August 2012 — Eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Studien belegt den Zusammenhang zwischen Glauben und Heilung und bestätigt seit Urzeiten gemachte Beobachtungen: Das denkende Wesen Mensch hat je nach Vertrauensniveau eine andere Beziehung zum Leben, zu Krankheit und zum Tod. Aus dem Vertrauen in sich selbst, in den Therapeuten, in die Wissenschaft, in Gott und über den Placebo-Effekt ergibt sich eine entscheidende Frage: Hilft Glaube bei der Heilung? Welchen Einfluss hat der Geist – beispielsweise durch Gebet oder Meditation – auf den Heilungsprozess? Welche Bedeutung können die eigenen Überzeugungen des Arztes in seiner Pflege- und Betreuungsbeziehung zum Patienten haben? Diese wichtigen Fragen werfen ein neues Licht auf die wesentlichen Fragen: Was ist Krankheit? Was bedeutet „Heilung“? Heilung ist letztlich immer Selbstheilung: Körper und Geist des Patienten bewirken die Heilung. Durch Zellregeneration gewinnt der Körper sein verlorenes Gleichgewicht zurück. Es ist oft sinnvoll, ja sogar notwendig, dem kranken Körper durch therapeutische Maßnahmen und die Einnahme von Medikamenten zu helfen. Diese unterstützen jedoch nur den Selbstheilungsprozess des Patienten. Auch die psychische Dimension, der Glaube, die Moral und das Beziehungsumfeld spielen in diesem Heilungsprozess eine entscheidende Rolle. Daher ist es der ganze Mensch, der zur Heilung mobilisiert wird. Das Gleichgewicht von Körper und Psyche kann nicht wiederhergestellt werden ohne den echten Einsatz des Patienten für die Wiedererlangung seiner Gesundheit, ohne Vertrauen in die geleistete Pflege und möglicherweise, bei manchen, ohne Vertrauen in das Leben im Allgemeinen oder in eine wohlwollende höhere Macht, die ihnen hilft. Ebenso kann manchmal eine Heilung, d. h. eine Wiederherstellung des Gleichgewichts, nicht erreicht werden, ohne dass sich auch das Umfeld des Patienten verändert: sein Rhythmus und Lebensstil, seine Ernährung, seine Art zu atmen oder seinen Körper zu behandeln, seine emotionalen, freundschaftlichen und beruflichen Beziehungen. Denn viele Krankheiten sind das lokale Symptom eines allgemeineren Ungleichgewichts im Leben des Patienten. Wenn sich der Patient dessen nicht bewusst ist, wird er von Krankheit zu Krankheit kranken oder an chronischen Krankheiten, Depressionen usw. leiden. Die Wege zur Heilung lehren uns, dass wir einen Menschen nicht wie eine Maschine behandeln können. Wir können einen Menschen nicht wie ein Fahrrad behandeln, indem wir ein verbogenes Rad oder einen platten Reifen wechseln. Es ist die soziale, emotionale und spirituelle Dimension des Menschen, die sich in Krankheit ausdrückt, und es ist diese globale Dimension, die bei der Behandlung berücksichtigt werden muss. Solange wir dies nicht wirklich integriert haben, besteht die Gefahr, dass Frankreich noch lange Weltmeister im Konsum von Anxiolytika und Antidepressiva und im Defizit seiner sozialen Sicherheit bleiben wird. Speichern [...]
Die Welt der Religionen Nr. 53 – Mai/Juni 2012 — Heute ist die Zeit eher reif für die Suche nach Identität, für die Wiederentdeckung der eigenen kulturellen Wurzeln, für gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Und leider zunehmend auch für Rückzug, Angst vor dem Anderen, moralische Starrheit und engen Dogmatismus. Keine Region der Welt, keine Religion entgeht dieser umfassenden globalen Bewegung der Rückkehr zu Identität und Normen. Von London bis Kairo, über Delhi, Houston oder Jerusalem ist die Zeit tatsächlich reif für Verschleierung oder Perücken für Frauen, für strenge Predigten und für den Triumph der Dogmenhüter. Im Gegensatz zu dem, was ich Ende der 1970er Jahre erlebte, interessieren sich junge Menschen, die sich noch für Religion interessieren, meist weniger aus einem Wunsch nach Weisheit oder der Suche nach Selbstfindung, sondern aus dem Bedürfnis nach starken Bezugspunkten und dem Wunsch, in der Tradition ihrer Väter verankert zu sein. Glücklicherweise ist diese Bewegung nicht unvermeidlich. Sie entstand als Gegenmittel zu den Exzessen der unkontrollierten Globalisierung und der brutalen Individualisierung unserer Gesellschaften. Sie war zugleich eine Reaktion auf den entmenschlichenden Wirtschaftsliberalismus und eine rasante Liberalisierung der Moral. Wir erleben also einen klassischen Pendelschwung. Nach der Freiheit kommt das Gesetz. Nach dem Individuum die Gruppe. Nach den Utopien des Wandels die Sicherheit vergangener Modelle. Ich erkenne zudem gerne an, dass diese Rückkehr zur Identität auch etwas Gesundes hat. Nach einem Übermaß an libertärem und konsumistischem Individualismus ist es gut, die Bedeutung sozialer Bindungen, des Gesetzes und der Tugend wiederzuentdecken. Was ich bedauere, ist die allzu rigorose und intolerante Art der meisten aktuellen Rückkehren zur Religion. Man kann einer Gemeinschaft wieder beitreten, ohne in den Kommunitarismus zu verfallen; man kann der uralten Botschaft einer großen Tradition anhängen, ohne sektiererisch zu werden; man kann ein tugendhaftes Leben führen wollen, ohne moralistisch zu sein. Angesichts dieser Starrheit gibt es glücklicherweise ein inneres Gegenmittel zu den Religionen: die Spiritualität. Je tiefer Gläubige in ihre eigene Tradition eintauchen, desto mehr Weisheitsschätze werden sie entdecken, die ihr Herz berühren und ihren Geist öffnen können. Sie erinnern sie daran, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind und dass Gewalt und die Verurteilung anderer schwerwiegendere Vergehen darstellen als die Übertretung religiöser Regeln. Die Entwicklung religiöser Intoleranz und Kommunitarismus bereitet mir Sorgen, nicht aber die Religionen als solche, die zwar das Schlimmste hervorbringen, aber auch das Beste. Speichern [...]
Le Monde des religions Nr. 52 – März/April 2012 — Die Frage, wie die Franzosen je nach Religion wählen, wird nur sehr selten thematisiert. Obwohl seit Beginn der Dritten Republik aufgrund des Säkularismus die Religionszugehörigkeit bei Volkszählungen nicht mehr abgefragt wird, gibt es Meinungsumfragen, die einige Einblicke in diese Thematik geben. Aufgrund der geringen Stichprobengröße können diese Umfragen jedoch zu kleine Religionen wie das Judentum, den Protestantismus oder den Buddhismus mit jeweils weniger als einer Million Anhängern nicht erfassen. Wir können uns jedoch ein genaues Bild vom Wahlverhalten derjenigen machen, die sich als Katholiken (rund 60 % der Franzosen, darunter 25 % praktizierend) und Muslime (rund 5 %) bezeichnen, sowie von Menschen, die sich als „konfessionslos“ bezeichnen (rund 30 % der Franzosen). Eine im Januar dieses Jahres durchgeführte Umfrage des Sofres/Pèlerin Magazine bestätigt die historischen rechtsgerichteten Wurzeln der französischen Katholiken. Im ersten Wahlgang würden 33 % für Nicolas Sarkozy stimmen, unter praktizierenden Katholiken steigt dieser Wert auf 44 %. Auch für Marine Le Pen würden 21 % stimmen, dieser Wert sinkt jedoch auf den nationalen Durchschnitt der praktizierenden Katholiken (18 %). Im zweiten Wahlgang würden 53 % der Katholiken für Nicolas Sarkozy stimmen, 47 % für François Hollande. 67 % der praktizierenden Katholiken würden für den rechten Kandidaten stimmen – unter den praktizierenden Katholiken sind es sogar 75 %. Diese Umfrage zeigt auch, dass Katholiken zwar wie alle Franzosen die Verteidigung von Arbeitsplätzen und die Erhaltung der Kaufkraft als ihre beiden wichtigsten Anliegen sehen, ihnen aber weniger Sorgen um die Verringerung von Ungleichheit und Armut als anderen am Herzen liegen … dafür aber mehr Sorgen um die Bekämpfung von Kriminalität. Glaube und evangelische Werte wiegen bei der politischen Wahl der Mehrheit der Katholiken letztlich weniger als wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Anliegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kandidat katholisch ist oder nicht. Es ist daher bemerkenswert, dass der einzige wichtige Präsidentschaftskandidat, der sich klar zu seinem katholischen Glauben bekennt, François Bayrou, unter den Katholiken nicht mehr Wahlabsichten auf sich zieht als unter der übrigen Bevölkerung. Die meisten französischen Katholiken, und insbesondere die praktizierenden, sind vor allem einem Wertesystem verbunden, das auf Ordnung und Stabilität basiert. François Bayrou jedoch vertritt in verschiedenen gesellschaftlichen Fragen mit grundlegender ethischer Relevanz einen progressiven Standpunkt. Dies reicht zweifellos aus, um einen guten Teil der traditionellen katholischen Wählerschaft zu verunsichern. Nicolas Sarkozy hat dies zweifellos gespürt, er, der in Bezug auf Bioethikgesetze, Homoelternschaft und gleichgeschlechtliche Ehe an den traditionellen katholischen Positionen festhält. Schließlich zeigen Umfragen des Zentrums für politische Forschung an Sciences Po, dass französische Muslime im Gegensatz zu Katholiken mit überwältigender Mehrheit links wählen (78 %). Obwohl drei Viertel von ihnen gering qualifizierte Jobs haben, beobachten wir dennoch ein Wahlverhalten, das speziell mit der Religion zusammenhängt: 48 % der muslimischen Arbeiter und Angestellten ordnen sich dem linken Spektrum zu, verglichen mit 26 % der katholischen Arbeiter und Angestellten und 36 % der Arbeiter und Angestellten ohne Religion. Insgesamt wählen auch die „Religionslosen“ – eine Kategorie, die weiterhin wächst – stark links (71 %). Es entsteht also eine seltsame Allianz zwischen den „Religionslosen“, die in gesellschaftlichen Fragen meist progressiv sind, und den französischen Muslimen, die in denselben Fragen zweifellos konservativer sind, aber einer „Jeder außer Sarkozy“-Logik folgen. [...]
Le Monde des religions Nr. 51 – Januar/Februar 2012 — Unser Dossier hebt eine wichtige Tatsache hervor: Spirituelle Erfahrungen in ihren vielfältigen Formen – Gebet, schamanische Trance, Meditation – hinterlassen einen physischen Eindruck im Gehirn. Über die daraus resultierenden philosophischen Debatten und die materialistischen oder spiritualistischen Interpretationen hinaus, die man daraus ziehen kann, lerne ich daraus eine weitere Lehre. Spiritualität ist in erster Linie eine gelebte Erfahrung, die Geist und Körper gleichermaßen berührt. Je nach kultureller Prägung bezieht sie sich auf ganz unterschiedliche Objekte oder Darstellungen: eine Begegnung mit Gott, mit einer unaussprechlichen oder absoluten Kraft, mit der geheimnisvollen Tiefe des Geistes. Gemeinsam ist diesen Darstellungen jedoch immer, dass sie eine Erschütterung des Seins, eine Erweiterung des Bewusstseins und oft auch des Herzens hervorrufen. Das Heilige, welchen Namen oder welche Form wir ihm auch geben, verwandelt denjenigen, der es erlebt. Und es bringt sein gesamtes Wesen durcheinander: emotionalen Körper, Psyche, Geist. Doch vielen Gläubigen bleibt diese Erfahrung verwehrt. Für sie ist Religion vor allem ein Kennzeichen persönlicher und kollektiver Identität, ein Moralkodex, ein Satz von Glaubenssätzen und Regeln, die es zu beachten gilt. Kurz gesagt, Religion wird auf ihre soziale und kulturelle Dimension reduziert. Wir können den historischen Moment benennen, in dem diese soziale Dimension der Religion auftauchte und allmählich die persönliche Erfahrung ablöste: den Übergang vom Nomadenleben, in dem der Mensch in Gemeinschaft mit der Natur lebte, zum sesshaften Leben, in dem er Städte gründete und die Geister der Natur – mit denen er durch veränderte Bewusstseinszustände in Kontakt kam – durch die Götter der Stadt ersetzte, denen er Opfer darbrachte. Schon die Etymologie des Wortes „Opfer“ – „das Heilige weihen“ – zeigt deutlich, dass das Heilige nicht mehr erfahren wird: Es geschieht durch eine rituelle Geste (ein Opfer an die Götter), die die Ordnung der Welt gewährleisten und die Stadt schützen soll. Und diese Geste wird vom zahlreich gewordenen Volk an einen spezialisierten Klerus delegiert. Religion erhält daher eine im Wesentlichen soziale und politische Dimension: Sie schafft Verbindungen und vereint eine Gemeinschaft um große Glaubenssätze, ethische Regeln und gemeinsame Rituale. Als Reaktion auf diese übermäßig äußerliche und kollektive Dimension treten um die Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. in allen Zivilisationen ganz unterschiedliche Weise auf, die die persönliche Erfahrung des Heiligen rehabilitieren wollen: Laotse in China, die Autoren der Upanishaden und Buddha in Indien, Zarathustra in Persien, die Begründer der Mysterienkulte und Pythagoras in Griechenland, die Propheten Israels bis hin zu Jesus. Diese spirituellen Strömungen entstehen oft innerhalb religiöser Traditionen, die sie durch ihre innere Auseinandersetzung zu transformieren versuchen. Diese außergewöhnliche Welle der Mystik, die Historiker durch ihre Konvergenz und Gleichzeitigkeit in den verschiedenen Kulturen der Welt immer wieder in Erstaunen versetzt, wird die Religionen erschüttern, indem sie eine persönliche Dimension einführt, die in vielerlei Hinsicht an die Erfahrung des wilden Heiligen primitiver Gesellschaften anknüpft. Und ich bin beeindruckt, wie sehr unsere Zeit dieser antiken Epoche ähnelt: Es ist dieselbe Dimension, die unsere Zeitgenossen zunehmend interessiert, von denen sich viele von der Religion distanziert haben, die sie als zu kalt, sozial und äußerlich empfinden. Dies ist das Paradoxon einer Ultramoderne, die versucht, sich wieder mit den archaischsten Formen des Heiligen zu verbinden: einem Heiligen, das mehr erfahren als „gemacht“ wird. Das 21. Jahrhundert ist daher sowohl religiös durch die Wiederbelebung der Identität angesichts der Ängste, die durch eine zu schnelle Globalisierung hervorgerufen werden, als auch spirituell durch das Bedürfnis nach Erfahrung und Seinsveränderung, das viele Menschen verspüren, ob religiös oder nicht. [...]
Le Monde des religions Nr. 50 – November/Dezember 2011 — Wird am 21. Dezember 2012 das Ende der Welt kommen? Lange Zeit habe ich dieser berühmten Prophezeiung der Maya keine Beachtung geschenkt. Doch seit einigen Monaten fragen mich viele Menschen danach und versichern mir oft, dass ihre Teenager durch die Informationen, die sie im Internet lesen, oder durch den Hollywood-Katastrophenfilm „2012“ beunruhigt seien. Ist die Prophezeiung der Maya glaubwürdig? Gibt es andere religiöse Prophezeiungen über das bevorstehende Ende der Welt, wie wir sie im Internet finden können? Was sagen die Religionen über das Ende der Zeiten? Das Dossier dieser Ausgabe beantwortet diese Fragen. Doch die Popularität dieses Gerüchts rund um den 21. Dezember 2012 wirft eine weitere Frage auf: Wie lässt sich die Angst vieler unserer Zeitgenossen erklären, die meisten von ihnen nicht religiös, und denen ein solches Gerücht plausibel erscheint? Ich sehe zwei Erklärungen. Zunächst einmal leben wir in einer besonders beunruhigenden Zeit, in der sich der Mensch fühlt, als säße er in einem Rennwagen, über den er die Kontrolle verloren hat. Tatsächlich scheint keine Institution, kein Staat in der Lage zu sein, den Wettlauf ins Ungewisse – und vielleicht in den Abgrund – zu bremsen, in den uns die Konsumideologie und die wirtschaftliche Globalisierung unter der Ägide des ultraliberalen Kapitalismus schleudern: dramatische Zunahme der Ungleichheit; ökologische Katastrophen, die den gesamten Planeten bedrohen; unkontrollierte Finanzspekulation, die die gesamte, global gewordene Weltwirtschaft schwächt. Hinzu kommen die Umwälzungen in unserem Lebensstil, die den westlichen Menschen zu einem amnesischen, entwurzelten Menschen gemacht haben, der aber ebenso unfähig ist, sich in die Zukunft zu projizieren. Unser Lebensstil hat sich im letzten Jahrhundert zweifellos stärker verändert als in den drei oder vier Jahrtausenden zuvor. Der Europäer „der Vergangenheit“ lebte überwiegend auf dem Land, war ein Naturbeobachter, verwurzelt in einer langsamen und solidarischen ländlichen Welt sowie in jahrhundertealten Traditionen. Dasselbe galt für den Menschen im Mittelalter und in der Antike. Der heutige Europäer ist überwiegend urban geprägt; er fühlt sich mit dem gesamten Planeten verbunden, hat jedoch keine starken lokalen Bindungen; er führt ein individualistisches Leben in einem hektischen Tempo und hat sich meist von den jahrhundertealten Traditionen seiner Vorfahren abgeschnitten. Wir müssen zweifellos bis zur Wende zur Jungsteinzeit zurückgehen (etwa 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung im Nahen Osten und etwa 3.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Europa), als die Menschen ihr nomadisches Leben als Jäger und Sammler aufgaben und sich in Dörfern niederließen, indem sie Ackerbau und Viehzucht entwickelten. Dort erlebte man eine so radikale Revolution, wie wir sie heute erleben. Dies bleibt nicht ohne tiefgreifende Folgen für unsere Psyche. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Revolution vollzog, führt zu Unsicherheit, einem Verlust grundlegender Bezugspunkte und der Instabilität sozialer Bindungen. Sie ist eine Quelle der Sorge, der Angst und eines verwirrenden Gefühls der Zerbrechlichkeit sowohl des Einzelnen als auch der menschlichen Gemeinschaften, was zu einer erhöhten Sensibilität für Themen wie Zerstörung, Vertreibung und Vernichtung führt. Eines scheint mir sicher: Wir erleben nicht die Symptome des Weltuntergangs, sondern das Ende einer Welt. Das Ende der traditionellen, mehrere tausend Jahre alten Welt, die ich gerade mit all den damit verbundenen Denkmustern beschrieben habe, aber auch das Ende der ultraindividualistischen und konsumorientierten Welt, die ihr folgte und in der wir immer noch versunken sind, die so viele Anzeichen von Erschöpfung zeigt und ihre wahren Grenzen für echten Fortschritt für Mensch und Gesellschaft offenbart. Bergson sagte, wir bräuchten eine „Ergänzung der Seele“, um den neuen Herausforderungen zu begegnen. Tatsächlich sehen wir in dieser tiefen Krise nicht nur eine Reihe vorhergesagter ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Katastrophen, sondern auch die Chance für einen Sprung nach vorn, eine humanistische und spirituelle Erneuerung durch ein Erwachen des Bewusstseins und ein geschärftes Gefühl individueller und kollektiver Verantwortung. [...]
Le Monde des religions Nr. 49 – September/Oktober 2011 — Das Erstarken von Fundamentalismus und Kommunitarismus aller Art ist eine der Hauptfolgen des 11. September. Diese Tragödie mit ihren weltweiten Auswirkungen hat die Kluft zwischen Islam und Westen offengelegt und verschärft, ebenso wie sie Symptom und Beschleuniger aller Ängste war, die mit der rasanten Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte und dem daraus resultierenden Kulturkonflikt verbunden waren. Doch diese Identitätsspannungen, die weiterhin Besorgnis erregen und die Medien ständig befeuern (das Massaker von Oslo im Juli ist eines der jüngsten Beispiele), haben eine andere, ganz gegenteilige Folge des 11. Septembers in den Hintergrund gedrängt: die Ablehnung des Monotheismus gerade wegen des Fanatismus, den er hervorruft. Jüngste Meinungsumfragen in Europa zeigen, dass monotheistische Religionen unsere Zeitgenossen zunehmend erschrecken. Die Worte „Gewalt“ und „Rückschritt“ werden heute eher mit ihnen assoziiert als mit „Frieden“ und „Fortschritt“. Eine der Folgen dieser Rückkehr zur religiösen Identität und des daraus oft resultierenden Fanatismus ist ein starker Anstieg des Atheismus. Während diese Bewegung im Westen allgemein verbreitet ist, ist das Phänomen in Frankreich am auffälligsten. Dort gibt es doppelt so viele Atheisten wie vor zehn Jahren, und die Mehrheit der Franzosen bezeichnet sich heute entweder als Atheisten oder Agnostiker. Natürlich liegen die Ursachen für diesen starken Anstieg von Unglauben und religiöser Gleichgültigkeit tiefer, und wir analysieren sie in dieser Ausgabe: die Entwicklung von kritischem Denken und Individualismus, der urbane Lebensstil, der Verlust religiöser Überlieferung usw. Doch es besteht kein Zweifel daran, dass die gegenwärtige religiöse Gewalt ein massives Phänomen der Loslösung von der Religion verstärkt, das weit weniger spektakulär ist als der mörderische Wahnsinn der Fanatiker. Man könnte das Sprichwort verwenden: Das Geräusch des fallenden Baumes übertönt das Geräusch des wachsenden Waldes. Da sie uns jedoch zu Recht beunruhigen und den Weltfrieden kurzfristig gefährden, konzentrieren wir uns viel zu sehr auf das Wiederaufleben von Fundamentalismen und Kommunitarismus und vergessen dabei, dass die wahre Veränderung im historischen Maßstab der tiefgreifende Niedergang der Religion und des uralten Glaubens an Gott in allen Bevölkerungsschichten ist. Man wird mir sagen, dass dieses Phänomen europäisch und in Frankreich besonders eindrucksvoll sei. Sicher, aber es nimmt weiter zu, und der Trend erreicht sogar die Ostküste der Vereinigten Staaten. Frankreich, einst die älteste Tochter der Kirche, könnte durchaus zur ältesten Tochter der religiösen Gleichgültigkeit werden. Der Arabische Frühling zeigt auch, dass das Streben nach individueller Freiheit universell ist und in der muslimischen Welt wie in der westlichen Welt letztlich die Emanzipation des Einzelnen von der Religion und den von Nietzsche prophezeiten „Tod Gottes“ zur Folge haben könnte. Die Hüter des Dogmas haben dies gut verstanden, sie, die ständig die Gefahren des Individualismus und Relativismus verurteilen. Aber können wir ein so grundlegendes menschliches Bedürfnis wie die Freiheit zu glauben, zu denken, die eigenen Werte und den Sinn des Lebens zu wählen, verhindern? Langfristig scheint mir die Zukunft der Religion nicht in kollektiver Identität und der Unterordnung des Einzelnen unter die Gruppe zu liegen, wie es jahrtausendelang der Fall war, sondern in der persönlichen spirituellen Suche und Verantwortung. Die Phase des Atheismus und der Ablehnung der Religion, in die wir immer tiefer eindringen, kann natürlich zu einem triumphierenden Konsumismus, Gleichgültigkeit gegenüber anderen und neuer Barbarei führen. Sie kann aber auch der Auftakt zu neuen Formen der Spiritualität sein, ob säkular oder religiös, die wirklich auf den großen universellen Werten gründen, nach denen wir alle streben: Wahrheit, Freiheit, Liebe. Dann wird Gott – oder vielmehr alle seine traditionellen Darstellungen – nicht umsonst gestorben sein. [...]
Le Monde des religions Nr. 48 – Juli/August 2011 — Während die Saga um die DSK-Affäre weiterhin hohe Wellen schlägt und zahlreiche Debatten und Fragen aufwirft, gibt es eine Lektion, die Sokrates dem jungen Alkibiades mitteilte und über die man nachdenken sollte: „Um die Stadt regieren zu können, muss man lernen, sich selbst zu regieren.“ Würde Dominique Strauss-Kahn, bis zu dieser Affäre der Favorit in den Umfragen, der sexuellen Gewalt gegen eine Putzfrau im Sofitel in New York für schuldig befunden, könnten wir nicht nur Mitleid mit dem Opfer haben, sondern auch tief aufatmen. Denn wenn DSK, wie auch einige Zeugenaussagen in Frankreich nahelegen, ein zu Brutalität fähiger Sexsüchtiger ist, hätten wir entweder einen Kranken (wenn er sich nicht beherrschen kann) oder einen Bösartigen (wenn er sich nicht beherrschen will) an die Spitze des Staates wählen können. Angesichts des Schocks, den die Nachricht von seiner Verhaftung in unserem Land auslöste, wagen wir es kaum zu fragen, was passiert wäre, wenn eine solche Affäre ein Jahr später ausgebrochen wäre! Der Schock der Franzosen, der an Verleugnung grenzt, ist größtenteils auf die Hoffnungen zurückzuführen, die man in DSK als seriösen und verantwortungsbewussten Mann setzte, der Frankreich regieren und in der Welt würdig vertreten würde. Diese Erwartung rührte aus der Enttäuschung über Nicolas Sarkozy, der für die Widersprüche zwischen seinen großen Erklärungen zu sozialer Gerechtigkeit und Moral und seiner persönlichen Einstellung, insbesondere zum Geld, hart verurteilt wurde. Wir hatten daher auf einen moralisch vorbildlicheren Mann gehofft. DSKs Sturz ist, unabhängig vom Ausgang des Prozesses, umso schwerer zu verdauen. Er hat jedoch den Vorteil, die Frage der Tugend in der Politik wieder in die öffentliche Debatte zu bringen. Denn während diese Frage in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung ist, wird sie in Frankreich, wo man dazu neigt, Privat- und Staatsleben, Persönlichkeit und Kompetenz strikt zu trennen, völlig unterschätzt. Ich denke, die richtige Haltung liegt zwischen diesen beiden Extremen: zu viel Moralismus in den Vereinigten Staaten, zu wenig Aufmerksamkeit für die persönliche Moral der Politiker in Frankreich. Denn ohne der amerikanischen Angewohnheit zu verfallen, unter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens „nach Sünden zu suchen“, dürfen wir nicht vergessen, wie Sokrates zu Alkibiades sagt, dass man an den guten Regierungsqualitäten eines Mannes zweifeln kann, der seinen Leidenschaften unterworfen ist. Höchste Verantwortung erfordert den Erwerb bestimmter Tugenden: Selbstbeherrschung, Klugheit, Respekt vor Wahrheit und Gerechtigkeit. Wie kann jemand, der sich diese elementaren moralischen Tugenden nicht aneignen konnte, sie in der Regierung der Stadt sinnvoll einsetzen? Wenn man sich auf höchster Staatsebene schlecht verhält, wie kann man dann von allen verlangen, sich gut zu verhalten? Konfuzius sagte vor 2.500 Jahren zum Herrscher von Ji Kang: „Sucht selbst das Gute, und das Volk wird sich bessern. Die Tugend des guten Menschen ist wie die des Windes.“ „Die Tugend des Volkes ist wie die des Grases, sie neigt sich in die Richtung des Windes“ (Gespräche, 19.12.). Auch wenn die Aussage für unsere modernen Ohren etwas paternalistisch klingt, ist sie nicht ohne Wahrheit. [...]
Le Monde des religions Nr. 47, Mai-Juni 2011 — Der Wind der Freiheit, der in den letzten Monaten durch die arabischen Länder wehte, beunruhigt die westlichen Kanzleien. Traumatisiert durch die iranische Revolution, unterstützten wir jahrzehntelang Diktaturen, die ein Bollwerk gegen den Islamismus sein sollten. Es war uns egal, dass die grundlegendsten Menschenrechte missachtet wurden, dass es keine Meinungsfreiheit gab, dass Demokraten inhaftiert wurden, dass eine kleine, korrupte Kaste alle Ressourcen des Landes zu ihrem eigenen Vorteil plünderte... Wir konnten ruhig schlafen: Diese gefügigen Diktatoren schützten uns vor der möglichen Machtergreifung unkontrollierbarer Islamisten. Was wir heute sehen, ist, dass diese Völker revoltieren, weil sie wie wir nach zwei Werten streben, die die Grundlage der Menschenwürde bilden: Gerechtigkeit und Freiheit. Es waren nicht bärtige Ideologen, die diese Revolten anzettelten, sondern verzweifelte arbeitslose Jugendliche, gebildete und empörte Männer und Frauen, Bürger aller sozialen Schichten, die ein Ende von Unterdrückung und Ungleichheit fordern. Menschen, die frei leben wollen, für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen, für Gerechtigkeit und eine unabhängige Presse. Diese Menschen, von denen wir dachten, sie könnten nur unter der eisernen Faust eines guten Diktators leben, erteilen uns heute eine beispielhafte Lektion in Sachen Demokratie. Hoffen wir, dass Chaos oder eine gewaltsame Machtübernahme die Flammen der Freiheit nicht ersticken. Und wie können wir so tun, als ob wir vergessen würden, dass wir vor zwei Jahrhunderten unsere Revolutionen aus denselben Gründen führten? Gewiss, der politische Islamismus ist Gift. Von der Ermordung koptischer Christen in Ägypten bis zur Ermordung des Gouverneurs von Punjab im Namen einer Reform des Blasphemiegesetzes in Pakistan verbreiten sie weiterhin Terror im Namen Gottes, und wir müssen mit aller Kraft gegen die Ausbreitung dieses Übels kämpfen. Aber wir werden ihn ganz sicher nicht durch die Unterstützung rücksichtsloser Diktaturen stoppen, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass der Islamismus sich vom Hass auf den Westen nährt, und ein guter Teil dieses Hasses entspringt genau diesem doppelten Diskurs, den wir ständig im Namen der Realpolitik führen: Ja zu den großen demokratischen Prinzipien, Nein zu ihrer Anwendung in muslimischen Ländern, um sie besser kontrollieren zu können. Ich möchte hinzufügen, dass mir diese Angst vor einer Machtübernahme der Islamisten immer weniger plausibel erscheint. Nicht nur, weil die Speerspitzen der aktuellen Aufstände in Tunesien, Ägypten oder Algerien sehr weit von islamistischen Kreisen entfernt sind, sondern auch, weil islamische Parteien, selbst wenn sie im künftigen demokratischen Prozess zwangsläufig eine wichtige Rolle spielen werden, äußerst geringe Chancen haben, eine Mehrheit zu erlangen. Und selbst wenn dies geschehen sollte, ist es, wie in der Türkei Mitte der 1990er Jahre, nicht sicher, ob die Bevölkerung ihnen die Einführung der Scharia und die Befreiung von Wahlsanktionen gestatten würde. Völker, die versuchen, langjährige Diktaturen loszuwerden, haben wenig Lust, unter das Joch neuer Despoten zu fallen, die ihnen ihre lang ersehnte und hart erkämpfte Freiheit nehmen würden. Die arabischen Völker haben die iranische Erfahrung sehr genau beobachtet und sind sich der Tyrannei der Ayatollahs und Mullahs über die gesamte Gesellschaft vollkommen bewusst. Gerade in einer Zeit, in der die Iraner versuchen, diesem grausamen theokratischen Experiment zu entkommen, werden ihre Nachbarn wahrscheinlich nicht davon träumen. Lassen wir daher unsere Ängste und unser politisches Kalkül beiseite und unterstützen wir die Menschen, die sich gegen ihre Tyrannen erheben, mit Begeisterung und vollem Herzen. [...]
Le Monde des religions Nr. 44, November-Dezember 2010 — Der enorme Erfolg von Xavier Beauvois’ Film Von Menschen und Göttern freut mich zutiefst. Diese Begeisterung ist nicht ohne Überraschungen, und ich möchte hier erklären, warum mich dieser Film berührt hat und warum er meiner Meinung nach so viele Zuschauer berührt hat. Seine erste Stärke liegt in seiner Nüchternheit und Langsamkeit. Keine großen Reden, wenig Musik, lange „Fahrtenaufnahmen“, bei denen die Kamera auf Gesichter und Haltungen fokussiert, anstatt einer Reihe schneller, abwechselnder Einstellungen wie in Trailern. In einer hektischen, lauten Welt, in der sich alles zu schnell bewegt, ermöglicht uns dieser Film, zwei Stunden lang in eine andere Zeitlichkeit einzutauchen, die zur Innerlichkeit führt. Manchen gelingt dies nicht und sie langweilen sich ein wenig, aber die meisten Zuschauer erleben eine sehr bereichernde innere Reise. Denn die Mönche von Tibhirine, gespielt von bewundernswerten Schauspielern, ziehen uns in ihren Glauben und ihre Zweifel hinein. Und das ist die zweite große Stärke des Films: Fernab von jeglichem Manichäismus zeigt er uns das Zögern der Mönche, ihre Stärken und Schwächen. Xavier Beauvois filmt so realitätsnah wie möglich und wird dabei perfekt von dem Ordensmann Henri Quinson unterstützt. Er zeichnet das Porträt von Männern, die das Gegenteil von Hollywood-Superhelden sind: gequält und gelassen zugleich, ängstlich und zuversichtlich, und die sich ständig fragen, ob es sinnvoll ist, an einem Ort zu bleiben, an dem sie jederzeit Gefahr laufen, ermordet zu werden. Diese Mönche, die dennoch ein Leben am anderen Ende unseres Lebens führen, kommen uns nahe. Wir sind, ob Gläubige oder Nichtgläubige, berührt von ihrem klaren Glauben und ihren Ängsten, wir verstehen ihre Zweifel, wir spüren ihre Verbundenheit mit diesem Ort und der Bevölkerung. Diese Loyalität zu den Dorfbewohnern, mit denen sie zusammenleben und die auch der Hauptgrund für ihre Weigerung zu gehen und damit für ihr tragisches Ende sein wird, stellt zweifellos die dritte Stärke dieses Films dar. Weil diese katholischen Mönche sich entschieden haben, in einem muslimischen Land zu leben, das sie zutiefst lieben, und weil sie ein Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis zur Bevölkerung pflegen, zeigt dies, dass der Zusammenprall der Kulturen keineswegs unvermeidlich ist. Wenn Menschen einander kennen und zusammenleben, verschwinden Ängste und Vorurteile, und jeder kann seinen Glauben leben und gleichzeitig den des anderen respektieren. Dies drückt der Prior des Klosters, Pater Christian de Chergé, in seinem geistlichen Testament, das Lambert Wilson am Ende des Films im Off vorliest, als die Mönche entführt werden und ihrem tragischen Schicksal entgegenziehen, auf bewegende Weise aus: „Sollte ich eines Tages – und das könnte heute sein – Opfer des Terrorismus werden, der offenbar alle in Algerien lebenden Ausländer erfasst, möchte ich, dass meine Gemeinde, meine Kirche und meine Familie sich daran erinnern, dass ich mein Leben Gott und diesem Land gewidmet habe. Ich habe lange genug gelebt, um zu wissen, dass ich Komplize des Bösen bin, das leider in der Welt zu herrschen scheint, und auch dessen, was mich blindlings treffen würde. Ich möchte, wenn die Zeit gekommen ist, diesen Moment der Klarheit erleben, der es mir erlaubt, Gott und meine Mitmenschen um Vergebung zu bitten und gleichzeitig jedem, der mir Schaden zugefügt hat, von ganzem Herzen zu vergeben. Die Geschichte dieser Mönche ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis, sondern auch eine wahre Lektion in Menschlichkeit. Link zum Video Speichern [...]
Le Monde des religions Nr. 43, September-Oktober 2010 — In seinem neuesten Essay* zeigt Jean-Pierre Denis, Chefredakteur der christlichen Wochenzeitung La Vie, wie sich die libertäre Gegenkultur, die im Mai 1968 entstand, in den letzten Jahrzehnten zur dominierenden Kultur entwickelt hat, während das Christentum zu einer Randerscheinung geworden ist. Die Analyse ist treffend, und der Autor plädiert eloquent für ein „Christentum des Widerspruchs“, das weder siegreich noch defensiv ist. Die Lektüre dieses Werks regt mich zum Nachdenken an, beginnend mit einer Frage, die vielen Lesern, gelinde gesagt, provokant erscheinen wird: War unsere Welt jemals christlich? Dass es eine sogenannte „christliche“ Kultur gab, geprägt von den Glaubensvorstellungen, Symbolen und Ritualen der christlichen Religion, liegt auf der Hand. Dass diese Kultur unsere Zivilisation tief durchdrungen hat, so dass unsere Gesellschaften selbst in säkularisierten Zeiten von einem allgegenwärtigen christlichen Erbe durchdrungen bleiben – Kalender, Feste, Gebäude, künstlerisches Erbe, volkstümliche Ausdrucksformen usw. – ist unbestreitbar. Aber war das, was Historiker „Christenheit“ nennen, dieser tausendjährige Zeitraum vom Ende der Antike bis zur Renaissance, der die Verbindung der christlichen Religion mit den europäischen Gesellschaften kennzeichnet, jemals im tiefsten Sinne christlich, das heißt der Botschaft Christi treu? Für Sören Kierkegaard, einen glühenden und gequälten christlichen Denker, ist „das gesamte Christentum nichts anderes als der Versuch der Menschheit, wieder auf die Beine zu kommen, das Christentum loszuwerden“. Der dänische Philosoph unterstreicht treffend, dass die Botschaft Jesu Moral, Macht und Religion völlig untergräbt, da sie Liebe und Ohnmacht über alles andere stellt. so sehr, dass die Christen sich schnell bemühten, sie dem menschlichen Geist näher zu bringen, indem sie sie in einen Rahmen aus Gedanken und traditionellen religiösen Praktiken einbetteten. Die Entstehung dieser „christlichen Religion“ und ihre unglaubliche Entstellung ab dem 4. Jahrhundert im Spannungsfeld politischer Macht steht sehr oft im Widerspruch zu der Botschaft, von der sie ihre Inspiration bezieht. Die Kirche ist als Gemeinschaft von Jüngern notwendig, deren Mission es ist, die Erinnerung an Jesus und seine Gegenwart durch das einzige von ihm eingesetzte Sakrament (die Eucharistie) weiterzugeben, sein Wort zu verbreiten und vor allem davon Zeugnis abzulegen. Aber wie können wir die Botschaft des Evangeliums im kanonischen Recht, im pompösen Anstand, im engen Moralismus, in der pyramidenförmigen kirchlichen Hierarchie, in der Vervielfältigung der Sakramente, im blutigen Kampf gegen Häresien, im Einfluss des Klerus auf die Gesellschaft mit all den damit verbundenen Exzessen erkennen? Das Christentum ist die erhabene Schönheit der Kathedralen, aber es ist auch all das. Ein Vater des Zweiten Vatikanischen Konzils rief angesichts des Endes unserer christlichen Zivilisation aus: „Das Christentum ist tot, es lebe das Christentum!“ Paul Ricoeur, der mir diese Anekdote einige Jahre vor seinem Tod erzählte, fügte hinzu: „Ich würde eher sagen: Das Christentum ist tot, es lebe das Evangelium! Denn es hat nie eine authentisch christliche Gesellschaft gegeben.“ Stellt der Niedergang der christlichen Religion nicht letztlich eine Chance dar, die Botschaft Christi wieder zu Gehör zu bringen? „Man kann keinen neuen Wein in alte Schläuche füllen“, sagte Jesus. Die tiefe Krise der christlichen Kirchen ist vielleicht der Auftakt zu einer neuen Renaissance des lebendigen Glaubens der Evangelien. Ein Glaube, der, weil er die Nächstenliebe als Zeichen der Liebe Gottes bezeichnet, eine starke Nähe zum säkularen Humanismus der Menschenrechte aufweist, die die Grundlage unserer modernen Werte bilden. Und ein Glaube, der auch eine Kraft des erbitterten Widerstands gegen die materialistischen und merkantilen Impulse einer zunehmend entmenschlichten Welt sein wird. So kann aus den Ruinen unserer „christlichen Zivilisation“ ein neues Gesicht des Christentums entstehen, für das Gläubige, die dem Evangelium mehr verbunden sind als der christlichen Kultur und Tradition, keine Nostalgie empfinden werden. * Warum das Christentum ein Skandal ist (Seuil, 2010). http://www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4 [...]
Le Monde des religions Nr. 42, Juli-August 2010 — Besonders Skeptiker sind erstaunt über die Beständigkeit astrologischer Glaubensvorstellungen und Praktiken in allen Kulturen der Welt. Seit den ältesten Hochkulturen Chinas und Mesopotamiens gab es keinen bedeutenden Kulturraum, in dem der Astralglaube nicht florierte. Und während man ihn im Westen seit dem 17. Jahrhundert und dem Aufkommen der wissenschaftlichen Astronomie für ausgestorben hielt, scheint er in den letzten Jahrzehnten in zweifacher Form wiederauferstanden zu sein: populär (Zeitungshoroskope) und kultiviert – die Psycho-Astrologie des Astralhoroskops, die Edgar Morin ohne Zögern als eine Art „neue Wissenschaft des Fachs“ bezeichnet. In den antiken Hochkulturen waren Astronomie und Astrologie miteinander verbunden: Die genaue Beobachtung des Himmelsgewölbes (Astronomie) ermöglichte die Vorhersage von Ereignissen auf der Erde (Astrologie). Diese Entsprechung zwischen Himmelsereignissen (Finsternissen, Planetenkonjunktionen, Kometen) und irdischen Ereignissen (Hungersnot, Krieg, Königstod) bildet die Grundlage der Astrologie. Auch wenn sie auf jahrtausendealten Beobachtungen beruht, ist die Astrologie keine Wissenschaft im modernen Sinne, da ihre Grundlagen unbeweisbar und ihre Praxis vielfältigen Interpretationen unterworfen ist. Es handelt sich vielmehr um symbolisches Wissen, das auf dem Glauben an eine geheimnisvolle Korrelation zwischen Makrokosmos (Kosmos) und Mikrokosmos (Gesellschaft, Individuum) beruht. In der Antike beruhte ihr Erfolg auf dem Bedürfnis der Reiche, mithilfe einer höheren Ordnung, dem Kosmos, zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Das Lesen der Zeichen des Himmels ermöglichte es, die Warnungen der Götter zu verstehen. Von einer politischen und religiösen Lesart entwickelte sich die Astrologie im Laufe der Jahrhunderte zu einer individuelleren und säkulareren Lesart. Im Rom der frühen Neuzeit suchte man einen Astrologen auf, um die Eignung eines bestimmten medizinischen Eingriffs oder beruflichen Vorhabens zu prüfen. Die moderne Wiederbelebung der Astrologie unterstreicht das Bedürfnis, sich selbst durch ein symbolisches Instrument, die Astralkarte, zu erkennen. Diese soll den Charakter des Einzelnen und die Grundzüge seines Schicksals offenbaren. Der ursprüngliche religiöse Glaube wird aufgegeben, nicht jedoch der Glaube an das Schicksal, da der Einzelne zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren werden soll, an dem das Himmelsgewölbe seine Möglichkeiten entfaltet. Dieses Gesetz der universellen Entsprechung, das die Verbindung zwischen Kosmos und Mensch ermöglicht, ist auch die Grundlage der sogenannten Esoterik, einer vielschichtigen religiösen Strömung parallel zu den großen Religionen, die ihre Wurzeln im Westen im Stoizismus (der Weltseele), im Neuplatonismus und in der antiken Hermetik hat. Das moderne Bedürfnis nach Verbindung mit dem Kosmos trägt zu diesem für die Postmoderne typischen Wunsch nach einer „Wiederverzauberung der Welt“ bei. Als sich Astronomie und Astrologie im 17. Jahrhundert trennten, waren die meisten Denker überzeugt, dass der astrologische Glaube wie ein Ammenmärchen für immer verschwinden würde. Eine abweichende Stimme erhob sich: Johannes Kepler, einer der Gründerväter der modernen Astronomie, zeichnete weiterhin Astralkarten und erklärte, man dürfe nicht versuchen, die Astrologie rational zu erklären, sondern sich auf die Beobachtung ihrer praktischen Wirksamkeit beschränken. Heute erlebt die Astrologie nicht nur im Westen eine gewisse Renaissance, sondern wird auch in den meisten asiatischen Gesellschaften weiterhin praktiziert. Damit entspricht sie einem so alten Bedürfnis wie der Menschheit: Sinn und Ordnung in einer so unvorhersehbaren und scheinbar chaotischen Welt zu finden. Ich möchte unseren Freunden Emmanuel Leroy Ladurie und Michel Cazenave herzlich für ihren langjährigen Beitrag danken, den sie in ihren Kolumnen in unserer Zeitung geleistet haben. Sie übergeben den Staffelstab an Rémi Brague und Alexandre Jollien, die wir herzlich begrüßen dürfen. http://www.youtube.com/watch?v=Yo3UMgqFmDs&feature=player_embedded [...]
Le Monde des religions Nr. 41, Mai-Juni 2010 — Die Frage nach dem Glück ist für die gesamte menschliche Existenz von zentraler Bedeutung und steht im Mittelpunkt der großen philosophischen und religiösen Traditionen der Menschheit. Ihr Wiederaufleben in den westlichen Gesellschaften zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist auf den Zusammenbruch der großen Ideologien und politischen Utopien zurückzuführen, die der Menschheit Glück bringen wollten. Der reine Kapitalismus ist als kollektives Sinnsystem ebenso gescheitert wie der Kommunismus oder der Nationalismus. Übrig bleibt die persönliche Suche, die es dem Einzelnen ermöglicht, ein glückliches Leben zu führen. Daher das erneute Interesse an antiken und östlichen Philosophien sowie die Entwicklung von Strömungen in monotheistischen Religionen, wie der evangelikalen Bewegung im christlichen Raum, die das irdische Glück und nicht mehr nur das Jenseits betonen. Liest man die vielen Standpunkte der großen Weisen und spirituellen Meister der Menschheit in diesem Dossier, spürt man eine permanente Spannung zwischen zwei Glückskonzeptionen, die die kulturelle Vielfalt überwindet. Einerseits wird Glück als stabiler, endgültiger und absoluter Zustand angestrebt. Es ist das versprochene Paradies im Jenseits, von dem man durch ein heiliges Leben hier auf Erden einen Vorgeschmack bekommen kann. Es ist auch das Streben buddhistischer oder stoischer Weiser, das darauf abzielt, hier und jetzt, jenseits aller Leiden dieser Welt, dauerhaftes Glück zu erlangen. Das Paradoxe an dieser Suche ist, dass sie theoretisch allen angeboten wird, aber Askese und den Verzicht auf alltägliche Freuden erfordert, zu denen nur wenige Menschen bereit sind. Am anderen Extrem wird Glück als zufällig, notwendigerweise vorübergehend und, alles in allem, als ziemlich ungerecht dargestellt, da es stark vom Charakter jedes Einzelnen abhängt: Wie Schopenhauer uns in Anlehnung an Aristoteles erinnert, liegt Glück in der Entfaltung unseres Potenzials, und tatsächlich gibt es eine radikale Ungleichheit im Temperament jedes Einzelnen. Glück, so seine Etymologie, verdankt sich daher dem Glück: „gute Stunde“. Und das griechische Wort Eudaimonia bezeichnet das Haben eines guten Dämons. Doch jenseits dieser Vielfalt an Standpunkten ist unter vielen Weisen aller Schulen eine Meinung zu hören, der ich mich voll und ganz anschließen kann: Glück hat vor allem mit einer gerechten Liebe zu sich selbst und zum Leben zu tun. Ein Leben, das man so akzeptiert, wie es sich präsentiert, mit seinen Freuden und Sorgen, und das versucht, das Unglück so weit wie möglich zu verdrängen, ohne jedoch von einer überwältigenden Fantasie des absoluten Glücks überwältigt zu werden. Ein Leben, das wir lieben, indem wir uns selbst so akzeptieren und lieben, wie wir sind, in einer „Freundschaft“ mit uns selbst, wie Montaigne es befürwortete. Ein Leben, das man mit Flexibilität angehen muss, begleitet von seiner ständigen Bewegung, wie dem Atmen, wie uns die chinesische Weisheit erinnert. Der beste Weg, so glücklich wie möglich zu sein, ist, „Ja“ zum Leben zu sagen. Video ansehen: Speichern Speichern Speichern Speichern [...]
Le Monde des religions Nr. 40, März-April 2010 — Benedikts XVI. Entscheidung, den Seligsprechungsprozess für Papst Pius XII. fortzusetzen, hat eine heftige Kontroverse ausgelöst, die sowohl die jüdische als auch die christliche Welt spaltet. Der Präsident der römischen Rabbinergemeinde boykottierte den Besuch des Papstes in der Großen Synagoge von Rom, um gegen Pius XII.s „passive“ Haltung gegenüber der Tragödie des Holocaust zu protestieren. Benedikt XVI. rechtfertigte die Entscheidung zur Heiligsprechung seines Vorgängers erneut mit dem Argument, er könne die Gräueltaten des Nazi-Regimes nicht offener verurteilen, ohne Repressalien gegen Katholiken zu riskieren, deren erste Opfer die Juden gewesen wären, von denen viele in Klöstern versteckt lebten. Dieses Argument ist völlig berechtigt. Der Historiker Léon Poliakov hatte bereits 1951 in der ersten Ausgabe des Breviers des Hasses, des Dritten Reiches und der Juden darauf hingewiesen: „Es ist schmerzlich festzustellen, dass das Papsttum während des gesamten Krieges, als die Todesfabriken auf Hochtouren liefen, schwieg. Man muss jedoch zugeben, dass, wie die Erfahrung auf lokaler Ebene gezeigt hat, auf öffentliche Proteste unmittelbar gnadenlose Sanktionen folgen konnten.“ Pius XII., ein guter Diplomat, versuchte, beide Seiten zufriedenzustellen: Er unterstützte die Juden im Geheimen und rettete nach der deutschen Besetzung Norditaliens direkt das Leben Tausender römischer Juden, vermied es jedoch, den Holocaust direkt zu verurteilen, um den Dialog mit dem Nazi-Regime nicht abzubrechen und eine brutale Reaktion zu vermeiden. Diese Haltung kann als verantwortungsbewusst, rational, umsichtig, ja sogar weise bezeichnet werden. Aber sie ist nicht prophetisch und entspricht nicht dem Handeln eines Heiligen. Jesus starb am Kreuz, weil er seiner Botschaft der Liebe und Wahrheit bis zum Ende treu geblieben war. Ihm nachgebend, geben die Apostel Petrus und Paulus ihr Leben, weil sie weder auf die Verkündigung der Botschaft Christi verzichten noch sie aus „diplomatischen Gründen“ den Umständen anpassen. Stellen Sie sich vor, sie wären anstelle von Pius XII. Päpste gewesen? Es ist schwer vorstellbar, dass sie sich mit dem Nazi-Regime arrangiert, sich aber stattdessen entschieden hätten, mit Millionen Unschuldigen deportiert zu werden. Dies ist der Akt der Heiligkeit, der prophetischen Bedeutung, den man angesichts solch tragischer historischer Umstände vom Nachfolger Petri erwarten konnte. Ein Papst, der sein Leben gibt und zu Hitler sagt: „Ich sterbe lieber mit meinen jüdischen Brüdern, als diese Gräueltaten zu dulden.“ Sicherlich wären die Repressalien für die Katholiken schrecklich gewesen, aber die Kirche hätte eine Botschaft von beispielloser Kraft an die ganze Welt gesendet. Die ersten Christen waren Heilige, weil sie ihren Glauben und ihre Nächstenliebe über ihr eigenes Leben stellten. Pius XII. wird heiliggesprochen, weil er ein frommer Mann, ein guter Verwalter der römischen Kurie und ein kluger Diplomat war. Dies ist die ganze Kluft, die zwischen der Kirche der Märtyrer und der nachkonstantinischen Kirche besteht, die mehr daran interessiert ist, ihren politischen Einfluss zu bewahren, als Zeugnis für das Evangelium abzulegen. [...]
Le Monde des religions Nr. 39, Januar-Februar 2010 — Fast vier Jahrhunderte nach Galileis Verurteilung scheint die öffentliche Debatte zum Thema Wissenschaft und Religion noch immer von zwei Extremen gespalten zu sein. Auf der einen Seite steht der Kreationismus, der im Namen einer fundamentalistischen Auslegung der Bibel bestimmte wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen will. Auf der anderen Seite steht die mediale Berichterstattung über die Arbeiten bestimmter Wissenschaftler wie Richard Dawkins („Das Ende Gottes“, Robert Laffont, 2008), die die Nichtexistenz Gottes mit wissenschaftlichen Argumenten beweisen wollen. Diese Positionen sind jedoch in beiden Lagern eher marginal. Im Westen erkennt eine große Mehrheit der Gläubigen die Legitimität der Wissenschaft an, und die meisten Wissenschaftler bekräftigen, dass die Wissenschaft niemals in der Lage sein wird, die Existenz oder Nichtexistenz Gottes zu beweisen. Grundsätzlich gilt, um einen Ausdruck Galileis selbst zu zitieren, als akzeptiert, dass Wissenschaft und Religion zwei Fragen radikal unterschiedlicher Art beantworten, die nicht miteinander in Konflikt geraten können: „Die Absicht des Heiligen Geistes ist es, uns zu lehren, wie wir in den Himmel kommen, und nicht, wie der Himmel ist.“ Im 18. Jahrhundert erinnerte Kant an den Unterschied zwischen Glauben und Vernunft und an die Unmöglichkeit der reinen Vernunft, die Frage nach der Existenz Gottes zu beantworten. Der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene Szientismus entwickelte sich dennoch zu einer wahren „Religion der Vernunft“ und verkündete dank der Siege der Wissenschaft wiederholt den Tod Gottes. Richard Dawkins ist einer seiner jüngsten Vertreter. Auch der Kreationismus entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die darwinistische Evolutionstheorie. Auf seine fundamentalistische, biblische Version folgte eine deutlich abgeschwächte Version, die die Evolutionstheorie zwar zulässt, aber die Existenz Gottes wissenschaftlich anhand der Theorie des Intelligent Design beweisen will. Eine verständlichere These, die jedoch in die alte Tradition der Verwechslung wissenschaftlicher und religiöser Ansätze zurückfällt. Wenn wir diese Unterscheidung des Wissens akzeptieren, die mir als grundlegende Errungenschaft des philosophischen Denkens erscheint, müssen wir dann behaupten, dass kein Dialog zwischen Wissenschaft und Religion möglich ist? Und allgemeiner, zwischen einer wissenschaftlichen Vision und einer spirituellen Auffassung von Mensch und Welt? Das Dossier in dieser Ausgabe gibt international renommierten Wissenschaftlern eine Stimme, die einen solchen Dialog fordern. Tatsächlich sind es weniger religiöse Menschen als vielmehr Wissenschaftler, die sich zunehmend für einen neuen Dialog zwischen Wissenschaft und Spiritualität einsetzen. Dies ist größtenteils auf die Entwicklung der Wissenschaft selbst im letzten Jahrhundert zurückzuführen. Ausgehend von der Untersuchung der unendlich kleinen (subatomaren) Welt haben die Theorien der Quantenmechanik gezeigt, dass die materielle Realität viel komplexer, tiefgründiger und geheimnisvoller ist, als man es sich nach den von Newton übernommenen Modellen der klassischen Physik vorstellen konnte. Am anderen Extrem, dem des unendlich Großen, haben astrophysikalische Entdeckungen über die Ursprünge des Universums, insbesondere die Urknalltheorie, die Theorien eines ewigen und statischen Universums hinweggefegt, auf die sich viele Wissenschaftler stützten, um die Unmöglichkeit eines schöpferischen Prinzips zu belegen. In geringerem Maße tendiert die Forschung zur Evolution des Lebens und zum Bewusstsein heute dazu, die szientistischen Visionen vom „Zufall, der alles erklärt“ und vom „neuronalen Menschen“ zu relativieren. Im ersten Teil dieses Dossiers teilen Wissenschaftler sowohl die Fakten – was sich in der Wissenschaft im letzten Jahrhundert verändert hat – als auch ihre eigene philosophische Meinung: Warum Wissenschaft und Spiritualität unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Methoden einen fruchtbaren Dialog führen können. Darüber hinaus legen andere Forscher, darunter zwei Nobelpreisträger, ihr eigenes Zeugnis als Wissenschaftler und Gläubige dar und legen die Gründe dar, die sie glauben lassen, dass Wissenschaft und Religion, weit davon entfernt, sich gegenseitig zu widersprechen, eher dazu neigen, sich anzunähern. Im dritten Teil des Dossiers kommen Philosophen zu Wort: Was halten sie von diesem neuen wissenschaftlichen Paradigma und dem Diskurs dieser Forscher, die einen neuen Dialog, ja sogar eine Annäherung zwischen Wissenschaft und Spiritualität befürworten? Was sind die Perspektiven und methodischen Grenzen eines solchen Dialogs? Jenseits steriler und emotionaler Polemik oder, im Gegenteil, oberflächlicher Annäherungen erscheinen mir diese Fragen und Debatten für ein besseres Verständnis der Welt und unserer selbst wesentlich. Speichern Speichern [...]
Le Monde des religions, November-Dezember 2009 – Religionen sind beängstigend. Heute ist die religiöse Dimension in unterschiedlichem Ausmaß in den meisten bewaffneten Konflikten präsent. Ganz abgesehen von Kriegen gehören religiöse Auseinandersetzungen zu den gewalttätigsten in westlichen Ländern. Religion trennt Menschen mehr, als dass sie sie eint. Warum? Von Anfang an hatte Religion eine doppelte verbindende Dimension. Vertikal schafft sie eine Verbindung zwischen Menschen und einem höheren Prinzip, wie auch immer wir es nennen: Geist, Gott, das Absolute. Das ist ihre mystische Dimension. Horizontal bringt sie Menschen zusammen, die sich durch den gemeinsamen Glauben an die unsichtbare Transzendenz vereint fühlen. Das ist ihre politische Dimension. Die lateinische Etymologie des Wortes „Religion“ bringt dies treffend zum Ausdruck: religere, „verbinden“. Eine Gruppe von Menschen wird durch gemeinsame Überzeugungen vereint, und diese sind, wie Régis Debray so treffend erklärte, umso stärker, weil sie sich auf eine abwesende, unsichtbare Kraft beziehen. Religion erhält daher eine herausragende identitätsstiftende Dimension: Jeder Einzelne fühlt sich durch diese religiöse Dimension einer Gruppe zugehörig, die zugleich einen wichtigen Teil seiner persönlichen Identität ausmacht. Alles ist in Ordnung, solange alle Menschen denselben Glauben teilen. Gewalt beginnt, wenn einzelne von der gemeinsamen Norm abweichen: Es ist die ewige Verfolgung von „Ketzern“ und „Ungläubigen“, die den sozialen Zusammenhalt der Gruppe bedrohen. Natürlich wird Gewalt auch außerhalb der Gemeinschaft ausgeübt, gegen andere Städte, Gruppen oder Nationen mit anderen Glaubensrichtungen. Und selbst wenn politische Macht von religiöser Macht getrennt ist, wird Religion aufgrund ihrer mobilisierenden identitätsstiftenden Dimension oft politisch instrumentalisiert. Wir erinnern uns an Saddam Hussein, einen Ungläubigen und Führer eines säkularen Staates, der während der beiden Golfkriege zum Dschihad aufrief, um „jüdische und christliche Kreuzfahrer“ zu bekämpfen. Die von uns in israelischen Siedlungen durchgeführte Umfrage liefert ein weiteres Beispiel. In einer sich rasch globalisierenden Welt, die Angst und Ablehnung hervorruft, erlebt Religion überall eine Wiederbelebung der Identität. Wir fürchten den Anderen, ziehen uns in uns selbst und unsere kulturellen Wurzeln zurück und hegen Intoleranz. Doch für Gläubige ist auch eine ganz andere Haltung möglich: Sie können ihren Wurzeln treu bleiben und sich gleichzeitig öffnen und mit anderen in ihren Unterschieden in Dialog treten. Sie können nicht zulassen, dass Religion von Politikern für kriegerische Zwecke missbraucht wird. Sie können zu den vertikalen Grundlagen jeder Religion zurückkehren, die Werte wie Respekt vor anderen, Frieden und die Aufnahme von Fremden vertreten. Sie können Religion mehr in ihrer spirituellen als in ihrer identitätsstiftenden Dimension erleben. Indem sie sich auf dieses gemeinsame Erbe spiritueller und humanistischer Werte stützen und nicht auf die Vielfalt der Kulturen und die sie trennenden Dogmen, können Religionen auf globaler Ebene eine friedensstiftende Rolle spielen. Davon sind wir noch weit entfernt, aber viele Einzelpersonen und Gruppen arbeiten in diese Richtung: Auch daran sollten wir uns erinnern. Wenn, um Péguys Worte zu verwenden, „alles in der Mystik beginnt und in der Politik endet“, ist es für Gläubige nicht unmöglich, auf der Grundlage der gemeinsamen mystischen Grundlage aller Religionen – dem Primat von Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung – auf den Aufbau eines friedlichen globalen politischen Raums hinzuarbeiten. Das heißt, auf die Entstehung einer brüderlichen Welt hinzuarbeiten. Religionen scheinen mir daher kein unumkehrbares Hindernis für ein solches Projekt darzustellen, das mit dem der Humanisten – ob gläubig, atheistisch oder agnostisch – im Einklang steht. [...]
Le Monde des religions, September-Oktober 2009 — Frankreich ist das europäische Land mit der größten muslimischen Bevölkerung. Die rasante Entwicklung des Islam im Land Pascals und Descartes in den letzten Jahrzehnten hat jedoch Ängste und Fragen geweckt. Ganz zu schweigen von den phantasievollen Diskursen der extremen Rechten, die diese Ängste zu schüren versuchen, indem sie einen Umbruch der französischen Gesellschaft unter dem „Druck einer Religion, die zur Mehrheit werden wird“ prophezeien. Ernsthafter gesagt: Einige Sorgen sind durchaus berechtigt: Wie lassen sich unsere säkulare Tradition, die Religion in die Privatsphäre verbannt, mit neuen religiösen Anforderungen an Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Orte vereinbaren? Wie lässt sich unser Bild einer emanzipierten Frau mit dem Aufstieg einer Religion vereinbaren, die starke Identitätssymbole wie das berühmte Kopftuch – ganz zu schweigen von der Vollverschleierung – besitzt, die für uns die Unterwerfung der Frau unter männliche Macht suggerieren? Es gibt tatsächlich einen Kultur- und Wertekonflikt, den zu leugnen gefährlich wäre. Doch Hinterfragen oder Kritik äußern bedeutet nicht zwangsläufig, Vorurteile zu verbreiten und in einer Abwehrhaltung, die von Angst vor dem Anderen und seiner Andersartigkeit getrieben ist, zu stigmatisieren. Aus diesem Grund widmete Le Monde des Religions den französischen Muslimen und der Frage des Islam in Frankreich ein umfangreiches, außergewöhnliches 36-seitiges Dossier. Diese Frage stellt sich seit zwei Jahrhunderten konkret mit der Ankunft der ersten Auswanderer und ist mit den Kriegen gegen die Sarazenen und der berühmten Schlacht von Poitiers sogar seit mehr als zwölf Jahrhunderten in unserer Vorstellung verwurzelt. Es ist daher notwendig, einen historischen Blick auf die Frage zu werfen, um die Ängste, Vorurteile und Werturteile, die wir gegenüber der Religion Mohammeds haben, besser zu verstehen (und nicht „Mahomet“, wie die Medien schreiben, ohne zu wissen, dass es sich dabei um einen türkischsprachigen Namen für den Propheten handelt, der aus dem Kampf gegen das Osmanische Reich geerbt wurde). Anschließend versuchten wir, die Galaxie der französischen Muslime anhand von Berichten über fünf große, sehr unterschiedliche (und nicht ausschließliche) Gruppen zu erkunden: ehemalige algerische Einwanderer, die ab 1945 zum Arbeiten nach Frankreich kamen; junge französische Muslime, die ihre religiöse Identität in den Vordergrund stellen; diejenigen, die zwar eine muslimische Identität annehmen, diese aber zunächst durch das Sieb der kritischen Vernunft und der humanistischen Werte der Aufklärung prüfen wollen; diejenigen, die sich vom Islam als Religion distanziert haben; und schließlich diejenigen, die Teil der fundamentalistischen salafistischen Bewegung sind. Dieses Mosaik der Identitäten offenbart die extreme Komplexität eines hochemotionalen und politisch sehr sensiblen Themas, das so weit geht, dass die Behörden sich weigern, religiöse und ethnische Zugehörigkeiten für Volkszählungen zu verwenden, die es uns ermöglichen würden, die französischen Muslime besser zu verstehen und ihre Zahl zu ermitteln. Wir hielten es daher für sinnvoll, diese Ausgabe mit Artikeln abzuschließen, die die Beziehung zwischen Islam und Republik oder das Thema „Islamophobie“ entschlüsseln und mehreren Wissenschaftlern mit einer distanzierten Sichtweise eine Stimme geben. Gemessen an der Zahl der Anhänger ist der Islam nach dem Christentum die zweitgrößte Religion der Menschheit. Er ist auch die zweitgrößte Religion in Frankreich, weit hinter dem Katholizismus, aber weit vor dem Protestantismus, dem Judentum und dem Buddhismus. Was auch immer man von dieser Religion hält, sie ist eine Tatsache. Eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft besteht darin, den Islam bestmöglich mit der französischen kulturellen und politischen Tradition in Einklang zu bringen. Dies kann – weder für Muslime noch für Nichtmuslime – in einem Klima der Ignoranz, des Misstrauens oder der Aggression erreicht werden. [...]
Le Monde des religions, Juli-August 2009 – Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise von beispiellosem Ausmaß, die unser auf permanentem Wachstum von Produktion und Konsum basierendes Entwicklungsmodell in Frage stellen sollte. Das Wort „Krise“ bedeutet im Griechischen „Entscheidung“, „Urteil“ und bezeichnet einen entscheidenden Moment, in dem „die Dinge entschieden werden müssen“. Wir befinden uns in einer kritischen Phase, in der grundlegende Entscheidungen getroffen werden müssen, sonst wird sich das Problem nur verschärfen – vielleicht zyklisch, aber sicher. Wie Jacques Attali und André Comte-Sponville in ihrem faszinierenden Dialog, den sie uns gewährten, in Erinnerung rufen, müssen diese Entscheidungen politischer Natur sein und mit einer notwendigen Sanierung und einer wirksameren und gerechteren Überwachung des fehlgeleiteten Finanzsystems, in dem wir heute leben, beginnen. Sie können auch alle Bürger direkter betreffen, indem sie die Nachfrage auf den Kauf ökologischerer und inklusiverer Güter umlenken. Ein nachhaltiger Ausweg aus der Krise wird sicherlich von der echten Entschlossenheit abhängen, die Spielregeln des Finanzwesens und unsere Konsumgewohnheiten zu ändern. Doch das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Es ist unser Lebensstil, der auf stetigem Konsumwachstum basiert und sich ändern muss. Seit der industriellen Revolution und noch stärker seit den 1960er Jahren leben wir in einer Zivilisation, die Konsum zur treibenden Kraft des Fortschritts macht. Diese treibende Kraft ist nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch ideologischer Natur: Fortschritt bedeutet, mehr zu besitzen. Die in unserem Leben allgegenwärtige Werbung bestärkt diesen Glauben in all seinen Formen. Können wir glücklich sein, ohne das neueste Auto zu besitzen? Den neuesten DVD-Player oder das neueste Handy? Einen Fernseher und Computer in jedem Zimmer? Diese Ideologie wird kaum hinterfragt: Solange es möglich ist, warum nicht? Und die meisten Menschen weltweit beäugen heute dieses westliche Modell, das Besitz, Anhäufung und ständigen Austausch materieller Güter zum ultimativen Sinn der Existenz macht. Wenn dieses Modell ins Stocken gerät, wenn das System entgleist; wenn es den Anschein macht, dass wir in diesem rasenden Tempo wahrscheinlich nicht ewig weiterkonsumieren können, die Ressourcen des Planeten begrenzt sind und Teilen dringend erforderlich wird, können wir uns endlich die richtigen Fragen stellen. Wir können den Sinn der Wirtschaft, den Wert des Geldes, die wahren Bedingungen für das Gleichgewicht einer Gesellschaft und individuelles Glück hinterfragen. Ich bin davon überzeugt, dass die Krise in dieser Hinsicht positive Auswirkungen haben kann und muss. Sie kann uns helfen, unsere Zivilisation, die zum ersten Mal global geworden ist, anhand anderer Kriterien als Geld und Konsum neu aufzubauen. Diese Krise ist nicht nur wirtschaftlicher und finanzieller, sondern auch philosophischer und spiritueller Natur. Sie wirft universelle Fragen auf: Was kann als wahrer Fortschritt betrachtet werden? Können Menschen in einer Zivilisation, die ganz auf dem Ideal des Habens aufbaut, glücklich sein und in Harmonie mit anderen leben? Wahrscheinlich nicht. Geld und der Erwerb materieller Güter sind nur Mittel, sicherlich wertvoll, aber niemals Selbstzweck. Der Wunsch nach Besitz ist von Natur aus unersättlich. Und er erzeugt Frustration und Gewalt. Der Mensch ist so beschaffen, dass er ständig das besitzen will, was er nicht hat, selbst wenn das bedeutet, es seinem Nächsten mit Gewalt wegzunehmen. Sobald jedoch die wesentlichen materiellen Bedürfnisse des Menschen erfüllt sind – Essen, ein Dach über dem Kopf und genug für ein anständiges Leben –, muss er sich einer anderen Logik als der des Habens zuwenden, um zufrieden zu sein und ein vollwertiger Mensch zu werden: der des Seins. Er muss lernen, sich selbst zu kennen und zu beherrschen, die Welt um sich herum zu verstehen und zu respektieren. Er muss lernen zu lieben, mit anderen zu leben, mit Frustrationen umzugehen, Gelassenheit zu erlangen, die unvermeidlichen Leiden des Lebens zu überwinden, sich aber auch darauf vorbereiten, sehenden Auges zu sterben. Denn wenn Existenz eine Tatsache ist, dann ist Leben eine Kunst. Eine Kunst, die man erlernt, indem man die Weisen befragt und an sich selbst arbeitet. [...]
Le Monde des religions, Mai-Juni 2009 – Die Exkommunikation der Mutter und des Ärzteteams, die die Abtreibung der neunjährigen Brasilianerin, die vergewaltigt wurde und mit Zwillingen schwanger war, durch den Erzbischof von Recife hat in der katholischen Welt einen Aufschrei ausgelöst. Viele Gläubige, Priester und sogar Bischöfe haben ihre Empörung über diese Disziplinarmaßnahme zum Ausdruck gebracht, die sie für übertrieben und unangemessen halten. Auch ich habe heftig reagiert und den eklatanten Widerspruch zwischen dieser brutalen und dogmatischen Verurteilung und der Botschaft des Evangeliums hervorgehoben, die Barmherzigkeit, Aufmerksamkeit für die Menschen und die Überwindung des Gesetzes durch Liebe befürwortet. Nachdem sich die Emotionen gelegt haben, erscheint es mir wichtig, auf diese Angelegenheit zurückzukommen – nicht um die Empörung zu verstärken, sondern um zu versuchen, das grundlegende Problem, das sie für die katholische Kirche offenbart, objektiv zu analysieren. Angesichts der Emotionen, die diese Entscheidung hervorrief, versuchte die brasilianische Bischofskonferenz, die Exkommunikation herunterzuspielen und die Mutter des Mädchens davon auszunehmen, unter dem Vorwand, sie sei vom Ärzteteam beeinflusst worden. Doch Kardinal Batista Re, Präfekt der Kongregation für die Bischöfe, drückte sich deutlicher aus und erklärte, der Erzbischof von Recife habe sich letztlich nur auf das kanonische Recht berufen. Dieses Gesetz besagt, dass jeder, der eine Abtreibung vornimmt, sich de facto aus der Gemeinschaft der Kirche herausstellt: „Wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich, wenn die Wirkung eintritt, die Exkommunikation latae sententiae zu“ (Kanon 1398). Niemand muss ihn offiziell exkommunizieren: Er hat sich durch seine Tat selbst exkommuniziert. Sicherlich hätte der Erzbischof von Recife den Hype vermeiden können, indem er lautstark auf das Kirchenrecht verwies und damit eine weltweite Kontroverse auslöste. Doch das löst keineswegs das grundlegende Problem, das so viele Gläubige schockiert hat: Wie kann ein christliches Gesetz – das Vergewaltigung zudem nicht als eine Tat ansieht, die schwerwiegend genug ist, um eine Exkommunikation zu rechtfertigen – Menschen verurteilen, die versuchen, das Leben eines vergewaltigten Mädchens durch eine Abtreibung zu retten? Es ist normal, dass eine Religion Regeln, Prinzipien und Werte hat und sich bemüht, diese zu verteidigen. In diesem Fall ist es verständlich, dass der Katholizismus, wie alle Religionen, Abtreibung ablehnt. Aber sollte dieses Verbot in einem unverletzlichen Gesetz verankert werden, das automatische Disziplinarmaßnahmen vorsieht und die Vielfalt der konkreten Fälle ignoriert? Darin unterscheidet sich die katholische Kirche von anderen Religionen und christlichen Konfessionen, die kein Äquivalent zum aus dem römischen Recht übernommenen Kirchenrecht und seinen Disziplinarmaßnahmen haben. Sie verurteilen bestimmte Handlungen grundsätzlich, wissen sich aber auch an die jeweilige Situation anzupassen und sind der Ansicht, dass die Übertretung der Norm manchmal ein „kleineres Übel“ darstellt. Dies wird im Fall dieses brasilianischen Mädchens deutlich. Abbé Pierre sagte dasselbe über AIDS: Es ist besser, das Risiko einer Übertragung der Krankheit durch Keuschheit und Treue zu bekämpfen, aber für diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, ist es besser, ein Kondom zu benutzen, als den Tod zu übertragen. Und man darf nicht vergessen, dass die Hirten der Kirche, wie es mehrere französische Bischöfe getan haben, diese Theologie des „kleineren Übels“ täglich praktizieren, sich an konkrete Fälle anpassen und Menschen in Schwierigkeiten mit Barmherzigkeit begleiten, was sie oft dazu bringt, die Regel zu brechen. Damit setzen sie lediglich die Botschaft des Evangeliums um: Jesus verurteilt den Ehebruch an sich, nicht aber die Frau, die beim Ehebruch ertappt wird, die die Eiferer des religiösen Gesetzes steinigen wollen und an die er ohne Berufung die Worte richtet: „Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie“ (Johannes 8). Kann eine christliche Gemeinschaft, die der Botschaft ihres Gründers treu bleiben und in einer Welt, die immer sensibler für das Leid und die Komplexität jedes Einzelnen wird, weiterhin disziplinarische Maßnahmen ohne Unterscheidungsvermögen anwenden? Sollte sie nicht gleichzeitig mit dem Ideal und der Norm auch die Notwendigkeit der Anpassung an jeden Einzelfall in Erinnerung rufen? Und vor allem bezeugen, dass die Liebe stärker ist als das Gesetz? [...]
Le Monde des religions, März-April 2009 – Die Krise, die durch Benedikts XVI. Entscheidung ausgelöst wurde, die Exkommunikation der vier von Erzbischof Lefebvre 1988 geweihten Bischöfe aufzuheben, ist noch lange nicht vorbei. Niemand kann dem Papst vorwerfen, dass er seine Aufgabe erfüllt und versucht, Schismatiker, die darum bitten, wieder in die Kirche zu integrieren. Die Probleme kommen von anderer Seite. Diese Ankündigung fiel mit der Veröffentlichung der abscheulichen Holocaust-leugnenden Äußerungen eines von ihnen, Erzbischof Williamson, zusammen. Dass die römische Kurie es nicht für nötig hielt, den Papst über die Positionen dieses Extremisten zu informieren, die in informierten Kreisen seit November 2008 bekannt waren, ist schon jetzt kein gutes Zeichen. Beunruhigend ist auch die Tatsache, dass Benedikt XVI. die Aufhebung der Exkommunikation (veröffentlicht am 24. Januar) nicht an die Bedingung knüpfte, dass er umgehend zum Widerruf solcher Aussagen aufgefordert wird (was allen am 22. Januar bekannt wurde) und dass es eine Woche dauerte, bis der Papst eine klare Stellungnahme zu dieser Frage abgab. Nicht, dass man ihn der Zusammenarbeit mit fundamentalistischen Antisemiten verdächtigen könnte – er bekräftigte am 12. Februar sehr deutlich, dass „die Kirche sich zutiefst und unwiderruflich der Ablehnung des Antisemitismus verpflichtet fühlt“ –, aber sein Zögern erweckte den Eindruck, als hätte er die Wiedereingliederung der Fundamentalisten zu einer absoluten, fast blinden Priorität gemacht und sich geweigert zu sehen, in welchem Ausmaß die meisten dieser Hardliner noch immer in Ansichten verhaftet sind, die der aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil hervorgegangenen Kirche völlig entgegengesetzt sind. Durch die Aufhebung der Exkommunikation und die Einleitung eines Integrationsprozesses, der der Priesterbruderschaft St. Pius X. einen Sonderstatus innerhalb der Kirche verleihen sollte, glaubte der Papst zweifellos, dass die letzten Jünger von Erzbischof Lefebvre sich schließlich ändern und die vom Zweiten Vatikanischen Konzil befürwortete Weltoffenheit akzeptieren würden. Die Fundamentalisten dachten genau das Gegenteil. Bischof Tissier de Mallerais, einer der vier von Erzbischof Lefebvre geweihten Bischöfe, erklärte wenige Tage nach der Aufhebung der Exkommunikation in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Stampa: „Wir werden unsere Positionen nicht ändern, aber wir beabsichtigen, Rom zu bekehren, das heißt, den Vatikan auf unsere Seite zu ziehen.“ » Derselbe Prälat hatte sechs Monate zuvor in der amerikanischen Zeitschrift The Angelus erklärt, die Priorität der Priesterbruderschaft St. Pius X. sei „unsere Beharrlichkeit bei der Ablehnung der Irrtümer des Zweiten Vatikanischen Konzils“, und sagte die Entstehung von „islamischen Republiken“ in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden voraus; und in Rom das Ende des Katholizismus, ein „organisierter Abfall vom jüdischen Glauben“. Die Priesterbruderschaft St. Pius X. steht heute kurz vor der Implosion, da die Meinungen über die beste Strategie gegenüber Rom auseinandergehen. Eines ist sicher: Die meisten dieser sektiererischen Extremisten haben nicht die Absicht, das aufzugeben, was ihre Identität und ihren Kampf seit vierzig Jahren begründet: die Ablehnung der vom Konzil befürworteten Prinzipien der Weltoffenheit, der Religionsfreiheit und des Dialogs mit anderen Religionen. Wie kann der Papst einerseits diese Fanatiker um jeden Preis in die Kirche aufnehmen und gleichzeitig den Dialog mit anderen christlichen Konfessionen und nichtchristlichen Religionen suchen? Johannes Paul II. besaß die Klarheit, eine eindeutige Entscheidung zu treffen, und es war zudem das Treffen mit den anderen Religionen in Assisi im Jahr 1986, das das Fass zum Überlaufen brachte und Erzbischof Lefebvre zum Bruch mit Rom veranlasste. Seit seiner Wahl hat Benedikt XVI. seine Gesten gegenüber den Fundamentalisten vervielfacht und den ökumenischen und interreligiösen Dialog weiterhin zurückgedrängt. Es ist verständlich, dass unter vielen Katholiken, darunter auch Bischöfen, die dem Geist des Dialogs und der Toleranz eines Konzils verbunden sind, das ein für alle Mal mit dem antimodernen Geist des unnachgiebigen Katholizismus brechen wollte, der Säkularismus, Ökumenismus, Gewissensfreiheit und Menschenrechte pauschal ablehnt, großes Unbehagen herrscht. Zur Feier seines fünfjährigen Jubiläums bietet Ihnen Le Monde des Religions ein neues Format, das die Zeitung sowohl formal (neues Layout, mehr Abbildungen) als auch inhaltlich verändert: eine umfangreichere Datei mit bibliographischen Referenzen, mehr Philosophie unter der Leitung von André Comte-Sponville, eine neue Eisenbahn – die Abschnitte „Geschichte“ und „Spiritualität“ werden durch die Abschnitte „Wissen“ und „Live-Erfahrung“ ersetzt – und neue Abschnitte: „Interreligiöser Dialog“, „24 Stunden im Leben von …“, „3 Schlüssel zum Verständnis des Denkens von …“, „Der Künstler und das Heilige“; eine neue Literaturkolumne von Leili Anvar; mehr Seiten mit kulturellen Nachrichten im Zusammenhang mit Religion (Kino, Theater, Ausstellungen). [...]
Le Monde des religions, Januar-Februar 2009 — Die verschiedenen Religionen dieser Welt haben weniger Gemeinsamkeiten, als man annehmen könnte. Allen voran die berühmte, tausendfach deklinierte Goldene Regel: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Ein weiteres Prinzip steht im eklatanten Widerspruch zu diesem Grundsatz und überrascht durch sein Alter, seine Beständigkeit und seine nahezu universelle Gültigkeit: die Verachtung der Frauen. Als wären Frauen potenzielle oder gescheiterte Menschen, dem männlichen Geschlecht gewiss unterlegen. Die historischen und textlichen Elemente, die wir in diesem Dossier zur Untermauerung dieser traurigen Feststellung anführen, sind nur allzu beredt. Warum diese Verachtung? Psychologische Motive sind zweifellos ausschlaggebend. Wie Michel Cazenave uns in Anlehnung an die Pioniere der Psychoanalyse in Erinnerung ruft, sind Männer sowohl eifersüchtig auf die weibliche Lust als auch verängstigt vor ihrem eigenen Verlangen nach Frauen. Die Sexualität ist zweifellos der Kern des Problems, und islamische Männer, die nur verschleierte Frauen tolerieren, haben die Kirchenväter, die Frauen nur als potenzielle Verführerinnen betrachteten, in nichts zu beneiden. Es gibt auch soziohistorische Gründe für diese Herabwürdigung der Frau in fast allen Kulturen, eine Herabwürdigung, zu der die Religionen entscheidend beigetragen haben. Der uralte Kult der „Großen Göttin“ zeugt von einer Aufwertung des Weiblichen. Die Schamanen der frühesten Religionen der Menschheit sind männlich oder weiblich, wie die Geister, die sie verehren, wie die bis heute erhaltenen mündlichen Überlieferungen belegen. Doch vor einigen Jahrtausenden, als sich Städte entwickelten und die ersten Königreiche entstanden, wurde der Bedarf an sozialer Organisation deutlich, und eine politische und religiöse Verwaltung entstand. Es waren jedoch Männer, die die Regierungsrolle übernahmen. Die für die Kultführung zuständigen Priester beeilten sich, das Pantheon zu maskulinisieren, und die männlichen Götter übernahmen, wie es auf Erden geschah, die Macht im Himmel. Die Monotheismen wiederum reproduzierten und verstärkten dieses polytheistische Muster nur, indem sie dem einen Gott ein ausschließlich männliches Gesicht gaben. Ein großes Paradoxon der Religionen seit Jahrtausenden: So verachtet, sind Frauen oft ihr wahres Herz; sie beten, übermitteln und fühlen mit dem Leid anderer. Heute entwickeln sich die Mentalitäten dank der Säkularisierung moderner Gesellschaften und der damit verbundenen Emanzipation der Frauen weiter. Leider zeigen bestimmte erschreckende Praktiken – wie diese fünfzehn afghanischen Teenagerinnen, die kürzlich auf dem Weg zu ihrer Schule in Kandahar mit Säure übergossen wurden – sowie Äußerungen aus einer anderen Zeit – wie die des Erzbischofs von Paris: „Es reicht nicht, Röcke zu tragen, man muss auch Dinge im Kopf haben“ –, dass noch ein langer Weg zurückgelegt werden muss, bis religiöse Traditionen Frauen endlich als gleichwertig mit Männern anerkennen und diese jahrhundertealten Spuren der Frauenfeindlichkeit aus ihren Lehren und Praktiken tilgen. [...]
Le Monde des religions, November-Dezember 2008 – Anlässlich des 40. Jahrestages der Enzyklika Humanae Vitae bekräftigte Benedikt XVI. entschieden die Ablehnung der Empfängnisverhütung durch die katholische Kirche. Davon ausgenommen sei die „Beachtung des natürlichen Rhythmus der Fruchtbarkeit der Frau“, wenn sich das Paar in einer „schweren Lage“ befinde, die einen zeitlichen Abstand zwischen den Geburten rechtfertige. Diese Bemerkungen lösten natürlich heftige Kritik aus und verdeutlichten einmal mehr die Kluft zwischen der Morallehre der Kirche und der Entwicklung der Moral. Diese Kluft scheint mir an sich keine berechtigte Kritik zu sein. Die Kirche ist kein Unternehmen, das seine Botschaft um jeden Preis verkaufen muss. Dass ihr Diskurs nicht mit der Entwicklung unserer Gesellschaften Schritt hält, kann auch ein heilsames Zeichen des Widerstands gegen den Zeitgeist sein. Der Papst ist nicht da, um die Revolution der Moral zu segnen, sondern um bestimmte Wahrheiten zu verteidigen, an die er glaubt, auch wenn dies bedeutet, Gläubige zu verlieren. Die eigentliche Kritik an dieser Verurteilung der Empfängnisverhütung betrifft das Argument, das sie rechtfertigt. Benedikt XVI. erinnerte daran, dass der Ausschluss der Möglichkeit, Leben „durch eine Handlung zur Verhinderung der Fortpflanzung“ zu schenken, einer „Leugnung der inneren Wahrheit der ehelichen Liebe“ gleichkommt. Indem das Lehramt der Kirche die Liebe der Eheleute untrennbar mit der Fortpflanzung verbindet, steht es im Einklang mit einer alten katholischen Tradition, die auf den heiligen Augustinus zurückgeht, der dem Fleisch und der fleischlichen Lust misstraute und sexuelle Beziehungen letztlich nur unter dem Gesichtspunkt der Fortpflanzung begreift. Kann ein unfruchtbares Paar daher in der Wahrheit der Liebe sein? Doch nichts in den Evangelien stützt eine solche Interpretation, und in anderen christlichen Traditionen, insbesondere in den östlichen, gibt es eine völlig andere Sichtweise von Liebe und menschlicher Sexualität. Es liegt hier also ein grundlegendes theologisches Problem vor, das einer völligen Neubetrachtung bedarf – nicht wegen der Entwicklung der Moral, sondern wegen einer höchst fragwürdigen Sichtweise von Sexualität und ehelicher Liebe. Ganz zu schweigen von den oft dramatischen sozialen Folgen, die ein solcher Diskurs in armen Bevölkerungsgruppen haben kann, wo Verhütung oft das einzige wirksame Mittel gegen die zunehmende Verarmung ist. Auch religiöse Persönlichkeiten wie Abbé Pierre und Schwester Emmanuelle – eine junge Hundertjährige, der ich alles Gute zum Geburtstag wünsche! – hatten diesbezüglich an Johannes Paul II. geschrieben. Zweifellos sind es diese tiefgreifenden Gründe und nicht nur die moralische Revolution, die viele Katholiken seit 1968 aus der Kirche austreten lassen. Wie Kardinal Etchegaray kürzlich sagte, stellte Humanae Vitae zu seiner Zeit ein „stilles Schisma“ dar, weshalb viele Gläubige von der Vision des Ehelebens, die die päpstliche Enzyklika vermittelte, schockiert waren. Diese enttäuschten Katholiken sind keine libertinen Paare, die ungezügelte Sexualität befürworten, sondern Gläubige, die sich lieben und nicht verstehen, warum die Wahrheit der Liebe ihres Paares durch ein vom Kinderwunsch losgelöstes Sexualleben aufgelöst werden sollte. Abgesehen von den extremsten Randgruppen vertritt keine andere christliche Konfession und überhaupt keine andere Religion eine solche Ansicht. Warum hat die katholische Kirche immer noch so große Angst vor fleischlicher Lust? Es ist verständlich, dass die Kirche an den heiligen Charakter des Geschenks des Lebens erinnert. Aber stellt Sexualität, die in echter Liebe erlebt wird, nicht auch eine Erfahrung des Heiligen dar? [...]
Le Monde des religions, September-Oktober 2008 — Wie ihr Name schon sagt, ist die Erklärung der Menschenrechte universell angelegt, d. h. sie soll auf einer natürlichen und rationalen Grundlage beruhen, die alle kulturellen Besonderheiten überwindet: Unabhängig von Geburtsort, Geschlecht oder Religion haben alle Menschen das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf freie Meinungsäußerung, auf ein menschenwürdiges Leben, auf Arbeit, Bildung und medizinische Versorgung. Diese universalistische Vision, die im 18. Jahrhundert im Zuge der europäischen Aufklärung entstand, hat in einigen Ländern in den letzten zwanzig Jahren zu ernsthaften Vorbehalten gegenüber dem universellen Charakter der Menschenrechte geführt. Dabei handelt es sich vor allem um Länder Asiens und Afrikas, die Opfer der Kolonialisierung waren und die Universalität der Menschenrechte mit einer kolonialistischen Haltung gleichsetzen: Nachdem der Westen seine politische und wirtschaftliche Vorherrschaft durchgesetzt hat, will er dem Rest der Welt seine Werte aufzwingen. Diese Staaten berufen sich auf das Konzept der kulturellen Vielfalt, um die Idee eines Relativismus der Menschenrechte zu verteidigen. Diese variieren je nach Tradition oder Kultur des jeweiligen Landes. Wir können solche Argumente verstehen, aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Sie passen Diktaturen überhaupt nicht und ermöglichen die Aufrechterhaltung von Praktiken der Herrschaft von Traditionen über den Einzelnen: die Beherrschung der Frau in tausend Formen (Beschneidung, Tod bei Ehebruch, Vormundschaft durch den Vater oder Ehemann), frühe Kinderarbeit, das Verbot des Religionswechsels usw. Diejenigen, die die Universalität der Menschenrechte ablehnen, haben dies gut verstanden: Die Anwendung dieser Rechte ermöglicht tatsächlich die Emanzipation des Einzelnen gegenüber der Gruppe. Doch welcher Einzelne strebt nicht nach Achtung seiner körperlichen und moralischen Unversehrtheit? Das Interesse der Gemeinschaft ist nicht immer das des Einzelnen, und hier steht eine grundlegende Entscheidung der Zivilisation auf dem Spiel. Andererseits ist es völlig legitim, westliche Regierungen dafür zu kritisieren, dass sie nicht immer das in die Tat umsetzen, was sie predigen! Die Legitimität der Menschenrechte wäre unendlich stärker, wenn Demokratien vorbildlich wären. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Art und Weise, wie die amerikanische Armee irakische Gefangene oder die Gefangenen in Guantánamo behandelte (Folter, fehlende Gerichtsverfahren, Vergewaltigung, Demütigung), hat dazu geführt, dass der Westen in den Augen vieler Bevölkerungsgruppen, denen wir Menschenrechtspredigten halten, jegliches moralische Ansehen verloren hat. Man wirft uns – und das zu Recht – vor, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Namen der Verteidigung von Werten wie der Demokratie in den Irak einmarschierten, obwohl allein wirtschaftliche Gründe zählten. Wir können unseren heutigen westlichen Gesellschaften auch einen übermäßigen Individualismus vorwerfen. Der Sinn für das Gemeinwohl ist weitgehend verschwunden, was den sozialen Zusammenhalt behindert. Doch wer würde sich angesichts dieses Mangels und einer Gesellschaft, in der der Einzelne völlig der Autorität der Gruppe und der Tradition unterworfen ist, wirklich für Letztere entscheiden? Die Achtung der grundlegenden Menschenrechte erscheint mir eine wesentliche Errungenschaft und ihr universelles Ziel legitim. Es bleibt also noch, eine harmonische Anwendung dieser Rechte in Kulturen zu finden, die noch stark von Traditionen, insbesondere religiösen, geprägt sind, was nicht immer einfach ist. Bei näherer Betrachtung jedoch zeigt sich, dass jede Kultur über eine inhärente Grundlage für Menschenrechte verfügt, und sei es nur durch die berühmte Goldene Regel, die Konfuzius vor 2.500 Jahren niederschrieb und die auf die eine oder andere Weise in das Herz aller Zivilisationen der Menschheit eingraviert ist: „Was du nicht auch für dich selbst tun würdest, das füg auch keinem anderen zu.“ [...]
Le Monde des religions, Juli-August 2008 — Wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Peking rückten die Unruhen in Tibet im vergangenen März die Tibet-Frage schlagartig wieder in den Mittelpunkt der internationalen Debatte. Angesichts der öffentlichen Empörung forderten westliche Regierungen die chinesische Regierung einstimmig auf, den Dialog mit dem Dalai Lama wieder aufzunehmen. Dieser fordert bekanntermaßen entgegen dem Willen der meisten seiner Landsleute nicht mehr die Unabhängigkeit seines Landes, sondern lediglich kulturelle Autonomie innerhalb Chinas. Zögerliche Kontakte wurden zwar geknüpft, doch alle informierten Beobachter wissen, dass sie wenig Aussicht auf Erfolg haben. Der derzeitige chinesische Präsident Hu Jintao war vor zwanzig Jahren Gouverneur Tibets und unterdrückte die Unruhen von 1987 bis 1989 so gewaltsam, dass er als „Schlächter von Lhasa“ bezeichnet wurde. Dies bescherte ihm einen deutlichen Aufstieg innerhalb der Partei, hinterließ aber auch einen tief verwurzelten Groll gegen den tibetischen Führer, der im selben Jahr den Friedensnobelpreis erhielt. Die Politik der chinesischen Führung, den Dalai Lama zu dämonisieren und auf seinen Tod zu warten, während sie gleichzeitig eine brutale Kolonialisierungspolitik in Tibet verfolgt, ist höchst riskant. Denn entgegen ihrer Behauptungen waren die Unruhen im vergangenen März, wie auch die vor zwanzig Jahren, nicht das Werk der tibetischen Exilregierung, sondern junger Tibeter, die die Unterdrückung, der sie ausgesetzt waren, nicht länger ertragen konnten: Inhaftierung wegen Meinungsverschiedenheiten, Verbot, in Regierungsbüros Tibetisch zu sprechen, vielfältige Einschränkungen der Religionsausübung, wirtschaftliche Bevorzugung chinesischer Siedler, deren Zahl die der Tibeter überstieg usw. Seit der Invasion Tibets durch die chinesische Volksarmee im Jahr 1950 hat diese Politik der Gewalt und Diskriminierung die nationalistischen Gefühle der Tibeter nur noch verstärkt, die einst ziemlich rebellisch gegen den Staat waren und ihr Zugehörigkeitsgefühl zu Tibet eher durch die Identität einer gemeinsamen Sprache, Kultur und Religion als durch ein politisches Gefühl nationalistischer Art lebten. Fast sechzig Jahre brutaler Kolonialisierung haben die nationalistischen Gefühle nur verstärkt, und eine überwältigende Mehrheit der Tibeter will die Unabhängigkeit ihres Landes zurück. Nur eine so legitime und charismatische Persönlichkeit wie der Dalai Lama kann sie dazu bewegen, diese legitime Forderung aufzugeben und mit den Behörden in Peking eine Einigung über eine Form tibetischer kultureller Autonomie in einem chinesischen Nationalraum zu erzielen, in dem beide Völker versuchen können, harmonisch zusammenzuleben. Am 22. März veröffentlichten dreißig in China lebende dissidente chinesische Intellektuelle einen mutigen Leitartikel in der ausländischen Presse, in dem sie betonten, dass die Dämonisierung des Dalai Lama und die Weigerung, größere Zugeständnisse an Tibet zu machen, China in die dramatische Sackgasse permanenter Repression führten. Dies verstärkt nur die antichinesische Stimmung unter den drei großen kolonisierten Völkern – Tibetern, Uiguren und Mongolen –, die von den kommunistischen Behörden als „Minderheiten“ bezeichnet werden und nur 3 % der Bevölkerung ausmachen, aber fast 50 % des Territoriums bewohnen. Wir möchten unserer frommen Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Olympischen Spiele in Peking keine Spiele der Schande sein werden, sondern dass sie den chinesischen Behörden die Möglichkeit geben, ihre Öffnung gegenüber der Welt und die Achtung der Menschenrechte voranzutreiben, angefangen bei der Freiheit des Einzelnen und der Völker zur Selbstbestimmung. [...]
Le Monde des religions, Mai-Juni 2008 – Die letzten Monate waren geprägt von kontroversen Diskussionen über das hochsensible Thema der Republik und der Religion in Frankreich. Wie wir wissen, gründet sich die französische Nation auf einer schmerzhaften Emanzipation von Politik und Religion. Von der Französischen Revolution bis zum Trennungsgesetz von 1905 hinterließen die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Republikanern tiefe Spuren. Während in anderen Ländern Religion eine wichtige Rolle bei der Gestaltung moderner Politik spielte und Gewaltenteilung nie zu Konflikten führte, war der französische Säkularismus ein kämpferischer Säkularismus. Grundsätzlich unterstütze ich Nicolas Sarkozys Idee, von einem kämpferischen Säkularismus zu einem friedlichen Säkularismus überzugehen. Aber ist das nicht bereits der Fall? Der Präsident der Republik hat Recht, wenn er an die Bedeutung des christlichen Erbes erinnert und die positive Rolle der Religionen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich betont. Das Problem ist, dass seine Bemerkungen zu weit gingen und zu Recht heftige Reaktionen hervorriefen. In Rom (20. Dezember) stellte er den Priester dem Lehrer gegenüber, einer emblematischen Figur der säkularen Republik, indem er behauptete, ersterer sei letzterem in der Wertevermittlung überlegen. Die Erklärung in Riad (14. Januar) ist noch problematischer. Sicherlich weist Nicolas Sarkozy zu Recht darauf hin, dass „nicht religiöse Gefühle gefährlich sind, sondern ihre Instrumentalisierung für politische Zwecke“. Dennoch legt er ein höchst überraschendes Glaubensbekenntnis ab: „Der transzendente Gott, der in den Gedanken und im Herzen eines jeden Menschen ist. Gott, der den Menschen nicht versklavt, sondern befreit.“ Der Papst hätte es nicht besser sagen können. Aus dem Mund des Präsidenten einer säkularen Nation sind diese Worte überraschend. Nicht, dass Nicolas Sarkozy nicht das Recht hätte, sie zu denken. Doch in einem offiziellen Kontext gesprochen, bewegen sie die Nation und können alle Franzosen, die Sarkozys spirituelle Ansichten nicht teilen, nur schockieren, ja sogar skandalisieren. Bei der Ausübung seines Amtes muss der Präsident der Republik Neutralität gegenüber den Religionen wahren: weder Verunglimpfung noch Entschuldigung. Man wird ihm entgegnen, dass amerikanische Präsidenten keine Hemmungen haben, in ihren Reden auf Gott zu verweisen, obwohl die amerikanische Verfassung politische und religiöse Macht ebenso formal trennt wie unsere. Gewiss, aber der Glaube an Gott und die messianische Rolle der amerikanischen Nation gehört zu den selbstverständlichen Wahrheiten, die von der Mehrheit geteilt werden, und begründet eine Art Zivilreligion. In Frankreich eint die Religion nicht, sie trennt. Wie wir wissen, ist der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert. Mit der edlen Absicht, die Republik und die Religion zu versöhnen, riskiert Nicolas Sarkozy durch Ungeschicklichkeit und Übereifer, genau das Gegenteil des angestrebten Ergebnisses zu erzielen. Ihre Kollegin Emmanuelle Mignon machte denselben Fehler bei der ebenso heiklen Frage der Sekten. Sie will mit einer manchmal allzu blinden Politik der Stigmatisierung religiöser Minderheiten brechen, die von vielen Juristen und Akademikern verurteilt wird – ich selbst habe den Parlamentsbericht von 1995 und die dazugehörige Liste mit den abweichenden Aussagen damals scharf kritisiert –, geht aber zu weit, wenn sie behauptet, Sekten seien „kein Problem“. Daher haben diejenigen, die sie zu Recht kritisiert, mit ebenso viel Recht darauf hinzuweisen, dass es schwerwiegende sektiererische Exzesse gibt, die keineswegs als unproblematisch betrachtet werden können! Wenn die höchsten Regierungsebenen es einmal wagen, die religiöse Frage auf eine neue und ungehemmte Weise anzusprechen, ist es bedauerlich, dass allzu starke oder unangemessene Positionen diese Sprache so unhörbar und kontraproduktiv machen. [...]
Le Monde des religions, März-April 2008 — Sehr geehrter Régis Debray, in Ihrer Kolumne, die ich dem Leser vor dem Weiterlesen empfehle, stellen Sie mich auf sehr anregende Weise infrage. Auch wenn Sie meine These zum Christentum etwas karikieren, gebe ich durchaus zu, dass wir unterschiedliche Standpunkte vertreten. Sie betonen dessen kollektiven und politischen Charakter, während ich auf dem persönlichen und spirituellen Charakter der Botschaft seines Gründers bestehe. Ich verstehe sehr gut, dass Sie die Grundlagen des sozialen Zusammenhalts in Frage stellen. In Ihren politischen Schriften haben Sie überzeugend dargelegt, dass dieser immer auf die eine oder andere Weise auf etwas „Unsichtbarem“ beruht, das heißt auf einer Form von Transzendenz. Der Gott der Christen war diese Transzendenz in Europa bis ins 18. Jahrhundert; ihm folgten die vergöttlichte Vernunft und der Fortschritt, dann der Vaterlandskult und die großen politischen Ideologien des 20. Jahrhunderts. Nach dem mitunter tragischen Scheitern all dieser säkularen Religionen bin ich wie Sie besorgt über den Platz, den Geld als neue Form der Religion in unseren individualistischen Gesellschaften einnimmt. Aber was können wir tun? Sollten wir dem Christentum nachtrauern, das heißt einer Gesellschaft, die vom christlichen Glauben regiert wird, so wie es heute Gesellschaften gibt, die vom islamischen Glauben regiert werden? Einer Gesellschaft nachtrauern, auf deren Altar die individuelle Freiheit und das Recht auf Andersdenken und Religion geopfert wurden? Ich bin davon überzeugt, dass diese Gesellschaft, die den Namen „christlich“ trug und darüber hinaus Großes geschaffen hat, der Botschaft Jesu nicht wirklich treu war, der einerseits die Trennung von Politik und Religion befürwortete und andererseits auf der individuellen Freiheit und der Würde des Menschen bestand. Ich sage nicht, dass Christus die Religion mit ihren Riten und Dogmen als Kitt einer Gesellschaft abschaffen wollte. Ich wollte aber zeigen, dass der Kern seiner Botschaft darauf abzielt, den Einzelnen von der Gruppe zu emanzipieren, indem er auf seiner persönlichen Freiheit, seiner inneren Wahrheit und seiner absoluten Würde beharrt. So sehr, dass unsere heiligsten modernen Werte – die Menschenrechte – weitgehend in dieser Botschaft verwurzelt sind. Christus, wie Buddha vor ihm und anders als andere Religionsstifter, geht es ihm nicht primär um Politik. Er schlägt eine Revolution des individuellen Bewusstseins vor, die langfristig zu einer Veränderung des kollektiven Bewusstseins führen dürfte. Weil der Einzelne gerechter, bewusster, wahrhaftiger und liebevoller wird, werden sich auch die Gesellschaften letztendlich weiterentwickeln. Jesus ruft nicht zu einer politischen Revolution auf, sondern zu einer persönlichen Bekehrung. Einer religiösen Logik, die auf Traditionsgehorsam beruht, stellt er eine Logik der individuellen Verantwortung entgegen. Ich gebe zu, diese Botschaft ist ziemlich utopisch, und wir leben gegenwärtig in einem gewissen Chaos, in dem die bisherige Logik, die auf dem Gehorsam gegenüber den heiligen Gesetzen der Gruppe beruhte, nicht mehr funktioniert und nur noch wenige Individuen in einen wahren Prozess der Liebe und Verantwortung eingebunden sind. Aber wer weiß, was in einigen Jahrhunderten geschehen wird? Ich möchte hinzufügen, dass diese Revolution des individuellen Bewusstseins in keiner Weise den religiösen oder politischen Überzeugungen der Mehrheit oder einer Institutionalisierung der Botschaft, auf deren Unvermeidlichkeit Sie zu Recht hinweisen, entgegensteht. Sie könnte ihnen jedoch eine Grenze setzen: die der Achtung vor der Würde des Menschen. Dies ist meiner Meinung nach die gesamte Lehre Christi, die die Religion keineswegs aufhebt, sondern sie in drei immaterielle Prinzipien einbettet: Liebe, Freiheit, Säkularismus. Und es ist eine Form der Heiligkeit, die, wie mir scheint, heute Gläubige und Nichtgläubige versöhnen kann. [...]
Le Monde des religions, Januar-Februar 2008 — Die Geschichte spielt in Saudi-Arabien. Eine 19-jährige verheiratete Frau trifft einen Freund aus Kindertagen. Dieser bittet sie in sein Auto, um ihm ein Foto zu geben. Sieben Männer kommen und entführen sie. Sie überfallen den Mann und vergewaltigen die Frau mehrmals. Letztere erstattet Anzeige. Die Vergewaltiger werden zu leichten Haftstrafen verurteilt, das Opfer und ihre Freundin werden vom Gericht zusätzlich zu 90 Peitschenhieben verurteilt, weil sie allein und privat mit einer Person des anderen Geschlechts waren, die nicht zu ihrer unmittelbaren Familie gehört (dieses Vergehen wird im islamischen Recht, der Scharia, Khilwa genannt). Die junge Frau beschließt, Berufung einzulegen, engagiert einen Anwalt und macht den Fall öffentlich. Am 14. November erhöht das Gericht ihre Strafe auf 200 Peitschenhiebe und verurteilt sie zusätzlich zu sechs Jahren Haft. Ein Beamter des Qatif General Court, der das Urteil am 14. November verkündete, erklärte, das Gericht habe die Strafe der Frau erhöht, weil sie „versucht habe, die Situation anzuheizen und die Justiz über die Medien zu beeinflussen“. Das Gericht schikanierte zudem ihren Anwalt, verbot ihm die Bearbeitung des Falls und entzog ihm seine Berufszulassung. Human Rights Watch und Amnesty International haben sich des Falls angenommen und versuchen, bei König Abdullah zu intervenieren, um die ungerechte Entscheidung des Gerichts zu kippen. Vielleicht gelingt ihnen das? Doch wie viele andere Frauen, die den Mut hatten, sich aufzulehnen und mit ihrer tragischen Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, werden vergewaltigt, ohne jemals Anzeige zu erstatten, aus Angst, selbst der Verführung des Vergewaltigers oder einer sündigen Beziehung mit einem anderen Mann beschuldigt zu werden? Die Lage der Frauen in Saudi-Arabien, wie auch in Afghanistan, Pakistan, Iran und anderen muslimischen Ländern, in denen die Scharia strikt gilt, ist unerträglich. Im gegenwärtigen internationalen Kontext wird jede Kritik westlicher NGOs oder Regierungen als inakzeptable Einmischung empfunden – nicht nur von politischen und religiösen Autoritäten, sondern auch von Teilen der Bevölkerung. Die Stellung der Frauen in muslimischen Ländern kann sich daher nur dann wirklich verbessern, wenn auch die öffentliche Meinung dort reagiert. Der gerade beschriebene Fall wurde in Saudi-Arabien weithin bekannt und löste eine gewisse Emotionalität aus. Es ist also dem außergewöhnlichen Mut einiger Frauen zu verdanken, die Opfer von Ungerechtigkeit geworden sind, aber auch der Männer, die sich für ihre Sache einsetzen, dass sich die Dinge ändern werden. Zunächst können sich diese Reformer auf die Tradition berufen, um zu zeigen, dass es andere Lesarten und Interpretationen des Korans und der Scharia gibt, die Frauen eine bessere Stellung einräumen und sie besser vor der Willkür eines Macho-Gesetzes schützen. Dies geschah 2004 in Marokko mit der Reform des Familienrechts, die einen erheblichen Fortschritt darstellt. Doch sobald dieser erste Schritt geschafft ist, werden sich die muslimischen Länder einer tiefgreifenderen Frage nicht entziehen können: der echten Emanzipation der Frauen von einer religiösen Auffassung und einem Recht, das vor Jahrhunderten in patriarchalischen Gesellschaften entwickelt wurde, die keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zuließen. Der Säkularismus hat diese jüngste Mentalitätsrevolution im Westen ermöglicht. Es besteht kein Zweifel, dass die endgültige Emanzipation der Frauen im Land des Islam auch eine völlige Trennung von Religion und Politik mit sich bringen wird. [...]
Le Monde des religions, September-Oktober 2007 – Ich war etwas überrascht über die auch innerhalb der Kirche heftige Kritik, die die Entscheidung des Papstes, die lateinische Messe wieder einzuführen, ausgelöst hat. Ich habe in den letzten zwei Jahren oft genug auf die ultrareaktionäre Politik Benedikts XVI. in allen Bereichen hingewiesen, um ihm nicht gerne zu Hilfe zu eilen! Der Papst möchte also natürlich die verlorenen Schafe von Erzbischof Lefebvre zurück in die Herde führen. Doch das ist kein Opportunismus seinerseits, denn Kardinal Ratzinger hat seit über dreißig Jahren immer wieder sein Unbehagen gegenüber der Umsetzung der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils und seinen Wunsch bekräftigt, den Gläubigen die Wahl zwischen dem neuen und dem alten Ritus zu lassen, der von Papst Pius V. (der ihn 1570 promulgierte) übernommen wurde. Dies wird ab dem 14. September geschehen. Warum sich über eine Maßnahme beschweren, die den Gläubigen – was selten vorkommt – echte Wahlfreiheit bietet? Nachdem das alte Ritual von seinen feindseligen Phrasen gegenüber Juden befreit wurde, die von den alten Grundlagen des christlichen Antijudaismus zeugten, der bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil fortbestand, kann ich nicht wirklich erkennen, wie die Messe von Pius V., die mit dem Rücken zu den Gläubigen und auf Latein gelesen wurde, einen schrecklichen Rückschritt für die Kirche darstellen sollte. Drei persönliche Erlebnisse überzeugen mich hingegen von der Richtigkeit der Entscheidung des Papstes. Ich war beeindruckt, als ich in Taizé feststellte, dass Tausende junger Menschen aus aller Welt auf Latein sangen! Frère Roger erklärte mir damals den Grund: Angesichts der Vielfalt der gesprochenen Sprachen hatte sich Latein als die von allen nutzbare liturgische Sprache etabliert. Ein ähnliches Erlebnis gab es in Kalkutta, in einer Kapelle der Missionarinnen der Nächstenliebe von Mutter Teresa, während der Messe für die vielen Freiwilligen aus aller Welt: Fast alle konnten an der Liturgie teilnehmen, da sie auf Latein gelesen wurde und die Kindheitserinnerungen der Teilnehmer sichtlich noch lebendig waren. Latein, die universelle liturgische Sprache der katholischen Kirche neben den Messen in den Volkssprachen – warum nicht? Meine letzte Erfahrung machte ich während einer soziologischen Umfrage, die ich vor etwa zehn Jahren unter Dutzenden französischen Anhängern des tibetischen Buddhismus durchführte: Ich war sehr überrascht, von mehreren zu hören, dass sie die tibetischen Riten schätzten, weil sie in einer Sprache abgehalten wurden, die nicht ihre Muttersprache war! Sie erzählten mir, dass sie die Sonntagsmesse auf Französisch armselig und ohne Mysterium fanden, während sie in den tibetischen Bräuchen das Heilige empfanden. Tibetisch diente als Latein. Wer weiß: Benedikt XVI. könnte nicht nur Fundamentalisten zurück in die Kirche führen (1). ... Le Monde des Religions wurde im September 2003 gegründet und feiert seinen vierten Geburtstag. Über die Qualität der Zeitung können Sie selbst urteilen. Aber die Finanzergebnisse sind äußerst positiv. Die durchschnittliche Auflage der Zeitschrift lag 2004 bei 42.000 Exemplaren. 2005 stieg sie sprunghaft auf 57.000 Exemplare und setzte ihr starkes Wachstum mit einer durchschnittlichen Auflage von 66.000 Exemplaren im Jahr 2006 fort. Laut der Zeitschrift Stratégies verzeichnete Le Monde des Religions 2006 das drittstärkste Wachstum in der französischen Presse. Dies ist eine Gelegenheit, Ihnen, liebe Leser, sowie allen, die die Zeitschrift machen, zu danken und auf die Neugestaltung der Forum-Seiten hinzuweisen, die dynamischer werden. Ich möchte auch Jean-Marie Colombani danken, der diesen Sommer seinen Posten als Direktor der Gruppe La Vie-Le Monde aufgegeben hat. Ohne ihn hätte Le Monde des Religions nie das Licht der Welt erblickt. Als er mich als Chefredakteur anwarb, sagte er mir, wie wichtig ihm eine Zeitschrift sei, die sich auf entschieden säkulare Weise mit Religion befasse. Er unterstützte uns auch weiterhin, als die Zeitschrift noch ein Defizit aufwies, und ließ uns stets völlige Freiheit bei unseren redaktionellen Entscheidungen. (1) Siehe die Debatte auf S. 17. [...]
Die Welt der Religionen, November-Dezember 2007 – Mutter Teresa zweifelte an der Existenz Gottes. Jahrzehntelang hatte sie den Eindruck, der Himmel sei leer. Diese Erkenntnis schockierte sie. Angesichts ihrer ständigen Bezugnahme auf Gott erscheint diese Tatsache erstaunlich. Zweifel ist jedoch nicht die Leugnung Gottes – es ist ein Hinterfragen – und Glaube ist nicht Gewissheit. Wir verwechseln Gewissheit mit Überzeugung. Gewissheit beruht auf unbestreitbaren, greifbaren Beweisen (diese Katze ist schwarz) oder auf universellem rationalen Wissen (Naturgesetze). Glaube ist eine individuelle und subjektive Überzeugung. Für manche Gläubige ist er eine weiche Meinung oder ein unkritisches Erbe, für andere eine mehr oder weniger starke innere Überzeugung. Aber in jedem Fall kann er keine greifbare oder rationale Gewissheit sein: Niemand wird jemals einen sicheren Beweis für die Existenz Gottes haben. Glauben heißt nicht wissen. Gläubige und Nichtgläubige werden immer hervorragende Argumente haben, um zu erklären, ob Gott existiert oder nicht: Keiner von beiden wird jemals etwas beweisen. Wie Kant zeigte, sind die Ordnung der Vernunft und die des Glaubens unterschiedlicher Natur. Atheismus und Glaube sind eine Frage der Überzeugung, und immer mehr Menschen im Westen bezeichnen sich als Agnostiker: Sie geben zu, in dieser Frage keine endgültige Überzeugung zu haben. Da Glaube weder auf greifbaren Beweisen (Gott ist unsichtbar) noch auf objektivem Wissen beruht, impliziert er zwangsläufig Zweifel. Und was paradox erscheint, aber völlig logisch ist: Dieser Zweifel ist proportional zur Intensität des Glaubens selbst. Ein Gläubiger, der nur schwach an die Existenz Gottes glaubt, wird seltener von Zweifeln überwältigt; weder sein Glaube noch seine Zweifel werden sein Leben auf den Kopf stellen. Umgekehrt wird ein Gläubiger, der intensive, leuchtende Momente des Glaubens erlebt hat oder sogar jemand, der wie Mutter Teresa sein ganzes Leben auf den Glauben gesetzt hat, die Abwesenheit Gottes letztendlich als schrecklich schmerzhaft empfinden. Der Zweifel wird zu einer existenziellen Prüfung. Dies ist es, was die großen Mystiker wie Theresia von Lisieux oder Johannes vom Kreuz erleben und beschreiben, wenn sie von der „dunklen Nacht“ der Seele sprechen, in der alle inneren Lichter erlöschen und der Gläubige im nacktesten Glauben zurückbleibt, weil er nichts mehr hat, worauf er sich stützen kann. Johannes vom Kreuz erklärt, dass Gott auf diese Weise, indem er den Anschein des Rückzugs erweckt, das Herz des Gläubigen prüft, um ihn auf dem Weg zur Vollkommenheit der Liebe weiterzuführen. Dies ist eine gute theologische Erklärung. Aus einer rationalen, vom Glauben unabhängigen Perspektive lässt sich diese Krise sehr gut damit erklären, dass der Gläubige nie Gewissheiten, objektives Wissen über die Grundlagen seines Glaubens haben kann und er zwangsläufig dazu kommt, sich selbst in Frage zu stellen. Die Intensität seines Zweifels steht im Verhältnis zur existenziellen Bedeutung seines Glaubens. Es gibt sicherlich sehr engagierte, sehr religiöse Gläubige, die behaupten, nie zu zweifeln: die Fundamentalisten. Besser noch, sie machen den Zweifel zu einem teuflischen Phänomen. Für sie bedeutet Zweifeln Versagen, Verrat, Versinken im Chaos. Weil sie Glauben fälschlicherweise als Gewissheit darstellen, verbieten sie sich innerlich und gesellschaftlich den Zweifel. Die Unterdrückung des Zweifels führt zu Spannungen aller Art: Intoleranz, ritueller Pointillismus, doktrinäre Starrheit, Dämonisierung von Ungläubigen, Fanatismus, der manchmal bis zu mörderischer Gewalt reicht. Fundamentalisten aller Religionen sind sich ähnlich, weil sie den Zweifel ablehnen, diese dunkle Seite des Glaubens, die dennoch seine unverzichtbare Folge ist. Mutter Teresa gestand ihre Zweifel ein, so schmerzhaft sie auch waren, denn ihr Glaube war von Liebe getrieben. Fundamentalisten werden ihre eigenen Zweifel niemals willkommen heißen oder zugeben, denn ihr Glaube gründet auf Angst. Und Angst verbietet Zweifel. PS: Ich freue mich sehr, Christian Bobin in unserem Kolumnistenkreis begrüßen zu dürfen. [...]
Die Welt der Religionen, Juli-August 2007 — Nach der Aufregung des 6. Juni 2006 (666) folgt nun die Euphorie des 7. Juli 2007 (777). Glücksspielhändler betonen die symbolische Bedeutung dieser Daten, Hollywood hat sich der berühmten Zahl des apokalyptischen Tieres (666) angenommen, und Bürgermeister erhalten überraschend viele Heiratsanträge für diesen berühmten 7. Juli. Doch wer unter den Anhängern der Zahl 7 kennt ihre Symbolik wirklich? Diese Zahl wurde im Altertum aufgrund der damals sichtbaren sieben Planeten als Zeichen der Fülle und Vollkommenheit eingeführt. In der hebräischen Bibel hat sie diesen Sinn der Vollendung bewahrt: Am siebten Tag ruht Gott nach den sechs Tagen der Schöpfung. Im Mittelalter griffen christliche Theologen diese Bedeutung auf und betonten, dass die Zahl 7 die Verbindung von Himmel (Zahl 3) und Erde (Zahl 4) manifestiere. Von da an begann man, ihre Präsenz in der Heiligen Schrift aufzuspüren und zu interpretieren: die sieben Gaben des Geistes, die sieben Worte Christi am Kreuz, die sieben Bitten des Vaterunsers, die sieben Kirchen der Apokalypse, ganz zu schweigen von den sieben Engeln, den sieben Posaunen und den sieben Siegeln. Auch die mittelalterliche Scholastik versucht, alles auf diese vollkommene Zahl zu reduzieren: die sieben Tugenden (die vier Kardinaltugenden, die vom Menschen kommen, und die drei theologischen Tugenden, die von Gott kommen), die sieben Sakramente, die sieben Todsünden, die sieben Kreise der Hölle... Die jüngste Begeisterung mancher unserer Zeitgenossen für die Symbolik der Zahlen (man denke auch an den weltweiten Erfolg der „Rätsel“ des Da Vinci Codes oder den Erfolg einer billigen Kabbala auf der anderen Seite des Atlantiks) basiert jedoch nicht mehr auf einer religiösen Kultur, die ihr Sinn und Kohärenz verliehen hätte. Sie läuft offensichtlich meist auf einen abergläubischen Ansatz hinaus. Spiegelt es jedoch nicht ein echtes Bedürfnis wider, sich wieder mit einem symbolischen Gedanken zu verbinden, der seit dem Triumph des Szientismus aus unseren modernen Gesellschaften verschwunden ist? Unter den vielen Definitionen des Menschen könnte man sagen, dass er das einzige zur Symbolisierung fähige Tier ist. Das einzige, das in der ihn umgebenden Welt nach einer verborgenen, tiefen Bedeutung sucht, die ihn mit einer inneren oder unsichtbaren Welt verbindet. Die griechische Etymologie des Wortes „Symbol“, sumbolon, bezieht sich auf einen Gegenstand, der in mehrere Teile zerlegt wurde und dessen Wiedervereinigung ein Zeichen der Wiedererkennung darstellt. Im Gegensatz zum Teufel (diabolon), der trennt, vereint und verbindet das Symbol. Es entspricht einem tief in der Psyche verankerten Bedürfnis, das Sichtbare und das Unsichtbare, das Äußere und das Innere zu verbinden. Deshalb erscheint das Symbol seit Anbeginn der Menschheit als Ausdruck der Tiefe des menschlichen Geistes und des religiösen Gefühls schlechthin (Religion, deren lateinische Etymologie religare auch „verbinden“ bedeutet). Wenn der prähistorische Mensch seine Toten auf ein Blumenkissen legt, verbindet er das Symbol der Blume mit der Zuneigung, die ihn mit ihnen verbindet. Legt er die Leichen in Embryonalstellung, mit dem Kopf nach Osten, assoziiert er die Symbolik des Fötus und der aufgehenden Sonne mit der Wiedergeburt und manifestiert so seinen Glauben oder seine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. In Anlehnung an die deutschen Romantiker zeigte Carl Gustav Jung, dass die Seele des modernen Menschen am Mangel an Mythen und Symbolen erkrankt. Zwar hat die Moderne neue Mythen und Symbole erfunden – etwa in der Werbung –, doch entsprechen sie nicht dem tiefen und universellen Sinnstreben unserer Psyche. Die Rückkehr von Astrologie und Esoterik in den letzten dreißig Jahren sowie die weltweiten Erfolge von Romanen wie „Der Herr der Ringe“, „Der Alchimist“, „Harry Potter“ oder „Die Chroniken von Narnia“ sind Anzeichen für das Bedürfnis nach einer „Wiederverzauberung der Welt“. Der Mensch kann sich tatsächlich nicht allein durch seine logische Vernunft mit der Welt und dem Leben verbinden. Er muss sich auch mit seinem Herzen, seiner Sensibilität, seiner Intuition und seiner Vorstellungskraft verbinden. Das Symbol wird dann zum Tor zur Welt und zu ihm selbst. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Mindestmaß an Erkenntnis und rationaler Urteilskraft. Denn sich allein dem magischen Denken zu überlassen, würde ihn im Gegenteil in einen Totalitarismus der Vorstellungskraft verwickeln, der zu einer wahnsinnigen Zeicheninterpretation führen könnte. [...]
Le Monde des religions, Mai-Juni 2007 – „Jesus Camp“. So heißt ein erbaulicher Dokumentarfilm über amerikanische Evangelikale, der am 18. April in die französischen Kinos kam. Wir begleiten die „Glaubensbildung“ von Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren aus evangelikalen Familien. Sie besuchen den Katechismusunterricht eines Missionars, eines Bush-Fans, dessen Worte erschreckend sind. Die armen Leute würden gerne Harry Potter lesen, wie ihre kleinen Freunde, doch der Katechet verbietet es ihnen ausdrücklich und weist lachend darauf hin, dass Zauberer Feinde Gottes seien und dass „Harry Potter im Alten Testament hingerichtet worden wäre“. Die Kamera fängt dann einen kurzen Moment des Glücks ein: Ein Kind geschiedener Eltern vertraut seinem Nachbarn schelmisch an, dass es die DVD des neuesten Teils sehen konnte … im Haus seines Vaters! Doch die Verurteilung der Verbrechen des Papierzauberers ist nichts im Vergleich zu der Gehirnwäsche, der diese Kinder im Sommercamp unterzogen werden. Die gesamte Agenda der amerikanischen Konservativen wird abgedeckt, und zwar in geschmacklosem Ton: ein Besuch eines Papp-Präsidenten Bush, den man als neuen Messias begrüßen soll; die Verteilung kleiner Plastikföten, um ihnen den Schrecken der Abtreibung vor Augen zu führen; eine radikale Kritik der darwinistischen Theorien zur Evolution der Arten … All das in einer permanenten Atmosphäre aus Karneval, Applaus und Gesang in verschiedenen Sprachen. Am Ende des Dokumentarfilms wird die Katechetin von einem Journalisten beschuldigt, eine regelrechte Gehirnwäsche an den Kindern durchzuführen. Die Frage schockiert sie überhaupt nicht: „Ja“, antwortet sie, „aber Muslime machen genau dasselbe mit ihren Kindern.“ Der Islam ist eine der Obsessionen dieser Bush-freundlichen Evangelikalen. Eine überraschende Szene beschließt den Film: Ein kleines Missionarsmädchen, etwa zehn Jahre alt, geht auf der Straße auf eine Gruppe Schwarzer zu und fragt sie, „wohin sie nach dem Tod gehen wollen“. Die Antwort macht sie sprachlos. „Sie sind überzeugt, in den Himmel zu kommen … obwohl sie Muslime sind“, vertraut sie ihrem jungen Missionskameraden an. „Sie müssen Christen sein“, schließt er nach kurzem Zögern. Diese Menschen sind nur dem Namen nach „evangelikal“. Ihre sektiererische (wir sind die wahren Auserwählten) und kriegerische (wir werden die Welt beherrschen, um sie zu bekehren) Ideologie ist das genaue Gegenteil der Botschaft des Evangeliums. Auch ihre Besessenheit von der Sünde, insbesondere der sexuellen Sünde, stößt uns ab. Wir denken, dass sich hinter dieser hartnäckigen Verurteilung von Sex (vor der Ehe, außerhalb der Ehe, zwischen Menschen des gleichen Geschlechts) viele unterdrückte Impulse verbergen müssen. Was gerade Reverend Ted Haggard, dem charismatischen Präsidenten der 30 Millionen Mitglieder zählenden National Evangelical Association of America, widerfahren ist, ist das perfekte Beispiel dafür. Wir sehen ihn im Film die Kinder anschreien. Was der Film jedoch nicht erwähnt – der Skandal kam erst später – ist, dass dieser Vorkämpfer des Kampfes gegen die Homosexualität vor einigen Monaten von einer Prostituierten aus Denver als besonders regelmäßiger und perverser Kunde denunziert wurde. Nachdem er die Tatsachen abgestritten hatte, bekannte sich der Pastor schließlich zu seiner Homosexualität, „diesem Dreck“, dem er seit Jahren ausgesetzt war, und begründete seinen Rücktritt in einem langen Brief an seine Anhänger. Dieses verlogene und heuchlerische Amerika Bushs ist erschreckend. Wir müssen jedoch unglückliche Verwechslungen vermeiden. Diese in ihren armseligen Gewissheiten und ihrer erschreckenden Intoleranz gefangenen christlichen Fundamentalisten, die ein wahres Spiegelbild der afghanischen Taliban sind, repräsentieren nicht alle der rund 50 Millionen amerikanischen Evangelikalen, von denen man bedenken muss, dass sie dem Irakkrieg größtenteils feindlich gegenüberstanden. Wir sollten uns auch davor hüten, diese gottesfürchtigen Menschen mit französischen Evangelikalen gleichzusetzen, die seit teilweise über einem Jahrhundert in Frankreich verwurzelt sind und deren Zahl heute über 350.000 in 1.850 Gotteshäusern liegt. Ihr emotionaler Eifer und ihr von amerikanischen Megakirchen inspirierter Missionarismus können uns beunruhigen. Das ist kein Grund, sie mit gefährlichen Sekten gleichzusetzen, wie es die Behörden in den letzten zehn Jahren allzu leichtfertig getan haben. Doch dieser Dokumentarfilm zeigt uns, dass die Gewissheit, „die Wahrheit zu besitzen“, Menschen mit wahrscheinlich besten Absichten schnell in hasserfülltes Sektierertum treiben kann. [...]
Le Monde des religions, März-April 2007 — Die von uns in unserer letzten Ausgabe veröffentlichte CSA-Umfrage unter französischen Katholiken wurde von über 200 Medien aufgegriffen und kommentiert. Sie hatte erhebliche Auswirkungen und löste zahlreiche Reaktionen in Frankreich und im Ausland aus. Sogar der Vatikan, vertreten durch Kardinal Poupard, reagierte und prangerte den „religiösen Analphabetismus“ der Franzosen an. Ich möchte auf einige dieser Reaktionen zurückkommen. Mitglieder der Kirche haben zu Recht darauf hingewiesen, dass der spektakuläre Rückgang der Zahl der Franzosen, die sich als Katholiken bezeichnen (51 % gegenüber 63 % in den letzten Umfragen), hauptsächlich auf die Formulierung der Frage zurückzuführen ist: „Welcher Religion gehören Sie an, falls Sie eine haben?“ anstelle der gebräuchlicheren Formel: „Welcher Religion gehören Sie an?“ Letztere Formulierung bezieht sich eher auf ein Gefühl der soziologischen Zugehörigkeit: Ich bin katholisch, weil ich getauft bin. Die von uns gewählte Formulierung schien für die Messung der persönlichen Zugehörigkeit viel relevanter und ließ zudem die Möglichkeit offener, sich als „religiös“ zu bezeichnen. Es ist ganz offensichtlich, wie ich bei der Veröffentlichung dieser Umfrage immer wieder betont habe, dass es mehr Getaufte als Menschen gibt, die sich zum Katholizismus bekennen. Eine Umfrage mit klassischer Formulierung würde wahrscheinlich andere Zahlen ergeben. Aber was ist interessanter zu wissen? Die Zahl der Menschen, die katholisch erzogen wurden, oder die derjenigen, die sich heute als Katholiken betrachten? Die Art und Weise, wie die Frage gestellt wird, ist nicht der einzige Faktor, der die erhaltenen Zahlen beeinflusst. Henri Tincq erinnert uns daran, dass das CSA-Institut 1994 für eine in Le Monde veröffentlichte Umfrage genau dieselbe Frage stellte wie für die 2007 in Le Monde des Religions veröffentlichte Umfrage: 67 % der Franzosen gaben damals an, katholisch zu sein, was den erheblichen Rückgang verdeutlicht, der in zwölf Jahren stattgefunden hat. Viele Katholiken – Geistliche wie Laien – fühlen sich auch durch den Rückgang des Glaubens in Frankreich entmutigt, der sich in einer Reihe von Zahlen ausdrückt: Unter denen, die sich als Katholiken bezeichnen, gibt es nur noch eine Minderheit von Gläubigen, die sich wirklich zum Glauben bekennen. Ich kann nicht anders, als diese Untersuchung im Hinblick auf das kürzliche Verschwinden zweier großer Gläubiger zu relativieren: der Dominikanerin Marie-Dominique Philippe und Abbé Pierre (1), die wahre Freunde waren. Diese beiden katholischen Persönlichkeiten mit so unterschiedlichem Hintergrund sagten mir im Wesentlichen dasselbe: Dieser jahrhundertelange Zusammenbruch des Katholizismus als vorherrschende Religion kann eine echte Chance für die Botschaft des Evangeliums darstellen: Wir könnten sie auf eine wahrere, persönlichere und gelebtere Weise wiederentdecken. In Abbé Pierres Augen ist es besser, wenige „glaubwürdige Gläubige“ zu haben als eine Masse lauwarmer Gläubiger, die durch ihr Handeln der Kraft der christlichen Botschaft widersprechen. Pater Philippe glaubte, dass die Kirche in der Nachfolge Christi die Passion des Karfreitags und das stille Begräbnis des Karsamstags durchleben müsse, bevor sie die Umwälzungen des Ostersonntags erlebe. Diese großen Gläubigen ließen sich vom Glaubensverfall nicht erschüttern. Im Gegenteil, sie sahen darin den möglichen Keim einer großen Erneuerung, eines bedeutenden spirituellen Ereignisses, das einer über siebzehn Jahrhunderte währenden Vermischung von Glauben und Politik ein Ende setzen sollte, die die Botschaft Jesu verzerrt hatte: „Dies ist mein neues Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“ Wie der Theologe Urs von Balthazar sagte: „Nur die Liebe ist des Glaubens würdig.“ Dies erklärt die enorme Popularität von Abbé Pierre und zeigt, dass die Franzosen, obwohl sie sich nicht als Katholiken fühlen, für die grundlegende Botschaft der Evangelien außerordentlich empfänglich bleiben. [...]
Le Monde des religions, Januar-Februar 2007 – „Frankreich, älteste Tochter der Kirche.“ Dieser Satz von Kardinal Langénieux aus dem Jahr 1896 bezieht sich auf die historische Realität eines Landes, in dem das Christentum im 2. Jahrhundert eingeführt wurde und das ab dem 9. Jahrhundert das Modell eines Volkes bot, das im Einklang mit Glauben, Symbolen und dem katholischen liturgischen Kalender lebte. Historiker nannten dies „Christenheit“. Mit der Französischen Revolution und der Trennung von Kirche und Staat im Jahr 1905 wurde Frankreich zu einem säkularen Land, in dem die Religion in die Privatsphäre verbannt wurde. Aus zahlreichen Gründen (Landflucht, moralische Revolution, Aufstieg des Individualismus usw.) hat der Katholizismus seitdem kontinuierlich an Einfluss auf die Gesellschaft verloren. Diese starke Erosion wird zuerst in den Statistiken der Kirche Frankreichs sichtbar, die einen stetigen Rückgang der Taufen, Eheschließungen und der Zahl der Priester zeigen (siehe S. 43-44). Dies lässt sich anhand von Meinungsumfragen nachvollziehen, die drei Merkmale hervorheben: Praxis (die Messe), Glaube (an Gott) und Zugehörigkeit (sich als katholisch identifizieren). Vierzig Jahre lang hat das umfassendste Kriterium der Religiosität, die regelmäßige Praxis, am stärksten abgenommen; 2006 waren nur noch 10 % der Franzosen davon betroffen. Der Glaube an Gott, der bis Ende der 60er Jahre mehr oder weniger stabil blieb (ca. 75 %), fiel 2006 auf 52 %. Das am wenigsten umfassende Kriterium, das der Zugehörigkeit, das sowohl eine religiöse als auch eine kulturelle Dimension betrifft, blieb bis Anfang der 90er Jahre sehr hoch (ca. 80 %). In den letzten 15 Jahren hat dieser Anteil wiederum einen spektakulären Rückgang erlebt: Im Jahr 2000 betrug er 69 %, 2005 61 % und liegt heute laut unserer Umfrage bei 51 %. Überrascht von diesem Ergebnis baten wir das CSA-Institut, die Umfrage mit einer landesweit repräsentativen Stichprobe von 2.012 Personen ab 18 Jahren zu wiederholen. Die Zahl blieb unverändert. Dieser Rückgang erklärt sich teilweise dadurch, dass 5 % der Befragten sich weigerten, sich auf der von den Meinungsforschungsinstituten vorgeschlagenen Liste der Religionen (katholisch, protestantisch, orthodox, jüdisch, muslimisch, buddhistisch, keine Religion usw.) eintragen zu lassen und spontan mit „christlich“ antworteten. Entgegen der Gewohnheit, diesen Prozentsatz zwangsweise der Kategorie „katholisch“ zuzuordnen, haben wir ihn als separate Kategorie aufgeführt. Es erscheint uns bedeutsam, dass Menschen mit katholischem Hintergrund diese Zugehörigkeit ablehnen, sich aber dennoch als Christen bezeichnen. Ohnehin bezeichnen sich immer weniger Franzosen als Katholiken, und immer mehr sagen, sie hätten „keine Religion“ (31 %). Andere Religionen, die stark in der Minderheit sind, bleiben mehr oder weniger stabil (4 % Muslime, 3 % Protestanten, 1 % Juden). Sehr aufschlussreich ist auch die Umfrage unter den 51 % der Franzosen, die sich zum Katholizismus bekennen (siehe Seiten 23 bis 28). Sie zeigt, wie weit die Gläubigen vom Dogma entfernt sind. Nicht nur glaubt jeder zweite Katholik nicht an die Existenz Gottes oder zweifelt daran, sondern von denen, die dies behaupten, glauben nur 18 % an einen persönlichen Gott (der dennoch eine der Grundlagen des Christentums darstellt), während 79 % an eine Kraft oder Energie glauben. Die Distanz zur Institution ist sogar noch größer, wenn es um Fragen der Moral oder Disziplin geht: 81 % befürworten die Priesterehe und 79 % die Ordination von Frauen. Und nur 7 % betrachten die katholische Religion als die einzig wahre Religion. Das Lehramt der Kirche hat daher fast jede Autorität über die Gläubigen verloren. Dennoch haben 76 % eine gute Meinung von der Kirche und 71 % von Papst Benedikt XVI. Dieses sehr interessante Paradoxon zeigt, dass die französischen Katholiken, die in der Bevölkerung zu einer Minderheit werden – und sich selbst sicherlich bereits als solche wahrnehmen –, die vorherrschenden Werte unserer zutiefst säkularisierten modernen Gesellschaften annehmen, aber wie jede Minderheit an ihrem gemeinschaftlichen Identifikationsmerkmal hängen bleiben: der Kirche und ihrem wichtigsten Symbol, dem Papst. Um es klar zu sagen: Frankreich ist nicht nur von seinen Institutionen, sondern auch von seiner Mentalität her kein katholisches Land mehr. Es ist ein säkulares Land, in dem der Katholizismus nach wie vor und zweifellos noch sehr lange die wichtigste Religion bleiben wird. Eine Zahl: Was wir als die „geringe Zahl“ regelmäßig praktizierender Katholiken wahrnehmen, entspricht zahlenmäßig der gesamten jüdischen, protestantischen und muslimischen Bevölkerung Frankreichs (einschließlich Nichtgläubiger und Nichtpraktizierender). [...]
Le Monde des religions, November-Dezember 2006 – Seit der Affäre um die Mohammed-Karikaturen mehren sich die Anzeichen von Spannungen zwischen dem Westen und dem Islam. Ich sollte eher sagen: zwischen einem Teil der westlichen und einem Teil der muslimischen Welt. Doch diese Krisen werfen die Frage auf: Darf man den Islam kritisieren? Viele muslimische Führer, und nicht nur extremistische Fanatiker, fordern im Namen des Respekts vor dem Glauben ein internationales Verbot von Religionskritik. Diese Haltung ist im Kontext von Gesellschaften verständlich, in denen Religion alles umfasst und das Heilige der höchste Wert ist. Doch die westlichen Gesellschaften sind längst säkularisiert und haben die religiöse Sphäre klar von der politischen getrennt. In diesem Rahmen garantiert der Staat allen Bürgern Gewissens- und Meinungsfreiheit. Jeder darf daher politische Parteien ebenso wie Religionen kritisieren. Diese Regel ermöglicht es unseren demokratischen Gesellschaften, freie Gesellschaften zu bleiben. Deshalb werde ich, auch wenn ich Robert Redekers Äußerungen gegen den Islam nicht teile, für sein Recht kämpfen, diese zu äußern, und den intellektuellen Terrorismus und die Morddrohungen, denen er ausgesetzt ist, aufs Schärfste verurteilen. Entgegen der Behauptung Benedikts XVI. war es weder die privilegierte Beziehung zur griechischen Vernunft noch der friedliche Diskurs seines Gründers, die dem Christentum den Verzicht auf Gewalt ermöglichten. Die jahrhundertelange Gewalt, die das Christentum – auch während des goldenen Zeitalters der thomistischen Rationaltheologie – ausübte, endete erst mit der Durchsetzung des säkularen Staates. Für einen Islam, der die modernen Werte des Pluralismus und der individuellen Freiheit integrieren will, gibt es daher keinen anderen Ausweg, als diesen Säkularismus und diese Spielregeln zu akzeptieren. Wie wir in unserer letzten Ausgabe zum Koran erläutert haben, erfordert dies eine kritische Auseinandersetzung mit Textquellen und traditionellem Recht, wie sie viele muslimische Intellektuelle praktizieren. In Bezug auf Säkularismus und Meinungsfreiheit müssen wir daher eindeutig sein. Es würde zudem die Wünsche und Bemühungen aller Muslime zunichtemachen, die weltweit in einem Raum der Freiheit und Säkularität leben wollen, wenn wir der Erpressung der Fundamentalisten nachgeben würden. Dennoch bin ich nachdrücklich davon überzeugt, dass wir eine verantwortungsvolle Haltung einnehmen und vernünftige Aussagen zum Islam treffen müssen. Im gegenwärtigen Kontext dienen Beleidigungen, Provokationen und Annäherungen nur dazu, ihren Urhebern zu gefallen und die Aufgabe gemäßigter Muslime zusätzlich zu erschweren. Wenn wir eine herzzerreißende, unbegründete Kritik oder eine gewalttätige Tirade gegen den Islam loslassen, provozieren wir mit Sicherheit eine noch heftigere Reaktion der Extremisten. Wir könnten dann zu dem Schluss kommen: „Seht ihr, ich hatte recht.“ Allerdings kommen auf drei Fanatiker, die so reagieren, 97 Muslime, die ihren Glauben friedlich leben oder einfach ihrer Herkunftskultur verbunden sind. Diese sind durch diese Bemerkungen und die Reaktion der Extremisten, die ein verheerendes Bild ihrer Religion zeichnen, doppelt verletzt. Um die Modernisierung des Islam zu unterstützen, ist ein kritischer, rationaler und respektvoller Dialog hundertmal wertvoller als Beschimpfungen und karikaturhafte Bemerkungen. Ich möchte hinzufügen, dass die Praxis der Vermischung ebenso schädlich ist. Die Quellen des Islam sind vielfältig, der Koran selbst ist pluralistisch, es gibt im Laufe der Geschichte unzählige Interpretationen, und die heutigen Muslime haben ebenso unterschiedliche Beziehungen zur Religion. Vermeiden wir daher vereinfachende Vermischungen. Unsere Welt ist zu einem Dorf geworden. Wir müssen lernen, mit unseren Unterschieden zusammenzuleben. Lassen Sie uns auf beiden Seiten sprechen, um Brücken zu bauen, statt wie derzeit Mauern zu errichten. [...]
Le Monde des religions, September-Oktober 2006 — Das Judasevangelium war der internationale Bestseller des Sommers(1). Ein außergewöhnliches Schicksal für diesen koptischen Papyrus, der nach siebzehn Jahrhunderten der Vergessenheit aus dem Sand gerettet wurde und dessen Existenz zuvor nur durch das Werk Gegen die Häresien (180) des Heiligen Irenäus bekannt war. Es handelt sich daher um eine wichtige archäologische Entdeckung(2). Es enthält jedoch keine Offenbarung über die letzten Momente im Leben Jesu, und es besteht kaum eine Chance, dass dieses kleine Buch „die Kirche stark aufrütteln“ wird, wie der Herausgeber auf der Rückseite des Umschlags verkündet. Erstens, weil der Autor dieses Textes, der Mitte des zweiten Jahrhunderts geschrieben wurde, nicht Judas war, sondern eine gnostische Gruppe, die die Urheberschaft der Geschichte dem Apostel Christi zuschrieb, um ihr mehr Bedeutung und Autorität zu verleihen (eine in der Antike gängige Praxis). Denn seit der Entdeckung von Nag Hammadi (1945), die die Aktualisierung einer wahren gnostischen Bibliothek mit zahlreichen apokryphen Evangelien ermöglichte, wissen wir viel mehr über den christlichen Gnostizismus, und letztlich wirft das Judasevangelium kein neues Licht auf das Denken dieser esoterischen Bewegung. Ist sein durchschlagender Erfolg, perfekt orchestriert von National Geographic, das die weltweiten Rechte erwarb, nicht allein seinem außergewöhnlichen Titel zu verdanken: „Das Judasevangelium“? Eine markante, undenkbare, subversive Wortkombination. Die Vorstellung, dass derjenige, den die vier kanonischen Evangelien und die christliche Tradition seit zweitausend Jahren als „Verräter“, „Bösewicht“, „Handlanger Satans“ darstellen, der Jesus für eine Handvoll Geld verkaufte, ein Evangelium geschrieben haben könnte, ist faszinierend. Dass er seine Version der Ereignisse erzählen wollte, um das Stigma zu lindern, das auf ihm lastet, ist ebenso wunderbar romantisch wie die Tatsache, dass dieses verlorene Evangelium nach so vielen Jahrhunderten der Vergessenheit wiedergefunden wurde. Kurz gesagt: Selbst wer den Inhalt dieses Büchleins nicht kennt, ist von einem solchen Titel fasziniert. Dies gilt umso mehr, als der Erfolg des „Sakrilegs“ deutlich gezeigt hat, da unsere Zeit den offiziellen Diskurs religiöser Institutionen über die Ursprünge des Christentums anzweifelt und die Figur des Judas, wie die der langen Liste der Opfer oder besiegten Gegner der katholischen Kirche, durch zeitgenössische Kunst und Literatur rehabilitiert wird. Judas ist ein moderner Held, ein bewegender und aufrichtiger Mann, ein enttäuschter Freund, der im Grunde ein Werkzeug des göttlichen Willens war. Denn wie hätte Christus sein Werk der universellen Erlösung vollbringen können, wenn er nicht von diesem Unglücklichen verraten worden wäre? Das Judas zugeschriebene Evangelium versucht, dieses Paradoxon aufzulösen, indem Jesus ausdrücklich sagt, Judas sei der größte der Apostel, weil er seinen Tod zulassen wird: „Aber du wirst sie alle übertreffen! Denn du wirst den Menschen opfern, der mir als fleischliche Hülle dient“ (56). Dieses Wort fasst das gnostische Denken gut zusammen: Welt, Materie und Körper sind das Werk eines bösen Gottes (des Gottes der Juden und des Alten Testaments); das Ziel des spirituellen Lebens besteht darin, dass die wenigen Auserwählten, die eine unsterbliche, göttliche Seele besitzen, die dem guten und unerkennbaren Gott entstammt, diese durch geheime Initiation aus dem Gefängnis ihres Körpers befreien können. Es ist durchaus amüsant festzustellen, dass unsere Zeitgenossen, die Toleranz und Materialismus bevorzugen und dem Christentum seine Verachtung des Fleisches vorwerfen, von einem Text einer Bewegung fasziniert sind, die ihrerzeit von den kirchlichen Autoritäten wegen ihres Sektierertums und weil sie das materielle Universum und den physischen Körper als Gräuel betrachtete, verurteilt wurde. 1. Das Judasevangelium, Übersetzung und Kommentar von R. Kasser, M. Meyer und G. Wurst, Flammarion, 2006, 221 S., 15 €. 2. Siehe Le Monde des Religions, Nr. 18. [...]
Le Monde des religions, Juli-August 2006 — Einer der Hauptgründe für die Anziehungskraft des Buddhismus im Westen ist die charismatische Persönlichkeit des Dalai Lama und sein Diskurs, der sich auf grundlegende Werte wie Toleranz, Gewaltlosigkeit und Mitgefühl konzentriert. Ein Diskurs, der durch seinen Mangel an Missionierung fasziniert, den wir von monotheistischen Religionen nicht gewohnt sind: „Konvertiere nicht, bleibe deiner Religion treu“, sagt der tibetische Meister. Ist das nur Fassade, die letztlich darauf abzielt, Westler zu verführen? Diese Frage wurde mir oft gestellt. Ich beantworte sie, indem ich von einem Erlebnis berichte, das mich tief bewegt hat. Es war vor einigen Jahren in Dharamsala, Indien. Der Dalai Lama hatte ein Treffen mit mir für ein Buch vereinbart. Ein einstündiges Treffen. Am Tag zuvor hatte ich im Hotel einen englischen Buddhisten, Peter, und seinen elfjährigen Sohn Jack kennengelernt. Peters Frau war einige Monate zuvor nach langer Krankheit und großem Leid gestorben. Jack hatte den Wunsch geäußert, den Dalai Lama zu treffen. Peter schrieb ihm daher und vereinbarte ein fünfminütiges Treffen, die Zeit für einen Segen. Vater und Sohn waren begeistert. Am nächsten Tag traf ich den Dalai Lama; Peter und Jack wurden kurz nach mir empfangen. Ich erwartete, dass sie sehr schnell ins Hotel zurückkehren würden; sie kamen erst am Ende des Tages an, völlig überwältigt. Ihr Treffen dauerte zwei Stunden. Peter erzählte mir Folgendes: „Als ich dem Dalai Lama vom Tod meiner Frau erzählte, brach ich in Tränen aus. Er nahm mich in die Arme, begleitete mich lange in diesen Tränen, begleitete meinen Sohn und sprach mit ihm. Dann fragte er mich nach meiner Religion: Ich erzählte ihm von meiner jüdischen Herkunft und der Deportation meiner Familie nach Auschwitz, die ich verdrängt hatte. Eine tiefe Wunde brach in mir auf, die Emotionen überwältigten mich, und ich weinte erneut. Der Dalai Lama nahm mich in die Arme. Ich spürte seine Tränen des Mitgefühls: Er weinte mit mir, genauso wie ich. Ich blieb lange in seinen Armen. Dann sprach ich mit ihm über meinen spirituellen Weg: mein mangelndes Interesse an der jüdischen Religion, meine Entdeckung Jesu durch die Lektüre der Evangelien, meine Bekehrung zum Christentum, das vor zwanzig Jahren der Lichtblick meines Lebens war. Dann meine Enttäuschung darüber, die Kraft der Botschaft Jesu in der anglikanischen Kirche nicht zu finden, meine allmähliche Distanzierung, mein tiefes Bedürfnis nach einer Spiritualität, die mir hilft zu leben, und meine Entdeckung des Buddhismus, den ich Ich praktizierte seit mehreren Jahren in seiner tibetischen Version. Als ich fertig war, schwieg der Dalai Lama. Dann wandte er sich an seinen Sekretär und sprach auf Tibetisch mit ihm. Dieser ging und kam mit einer Jesus-Ikone zurück. Ich war erstaunt. Der Dalai Lama gab sie mir und sagte: „Buddha ist mein Weg, Jesus ist dein Weg.“ Ich brach zum dritten Mal in Tränen aus. Plötzlich entdeckte ich all die Liebe wieder, die ich zu Jesus empfand, als ich zwanzig Jahre zuvor konvertierte. Ich verstand, dass ich Christ geblieben war. Ich suchte im Buddhismus nach Unterstützung für die Meditation, doch tief in meinem Inneren berührte mich nichts mehr als die Person Jesu. In weniger als zwei Stunden versöhnte mich der Dalai Lama mit mir selbst und heilte tiefe Wunden. Beim Abschied versprach er Jack, ihn jedes Mal wiederzusehen, wenn er nach England käme. Ich werde diese Begegnung und die veränderten Gesichter dieses Vaters und seines Sohnes nie vergessen. Sie zeigten mir, dass das Mitgefühl des Dalai Lama keine leere Phrase ist und dem christlicher Heiliger in nichts nachsteht. Die Welt der Religionen, Juli-August 2006. [...]
Le Monde des religions, Mai-Juni 2006 — Nach dem Roman der Film. Der französische Kinostart von „Sakrileg“ am 17. Mai dürfte die Spekulationen über die Gründe für den weltweiten Erfolg von Dan Browns Roman neu entfachen. Die Frage ist interessant, vielleicht sogar interessanter als der Roman selbst. Denn Fans historischer Thriller – und ich gehöre dazu – sind sich ziemlich einig: „Sakrileg“ ist kein herausragender Jahrgang. Der Roman ist wie ein Pageturner aufgebaut und fesselt einen von den ersten Seiten an, und die ersten zwei Drittel des Buches verschlingt man mit Vergnügen, trotz des hastigen Stils und der mangelnden Glaubwürdigkeit und psychologischen Tiefe der Charaktere. Dann verliert die Handlung an Schwung, bevor sie in ein „Abrakadabra“-Ende mündet. Die über 40 Millionen verkauften Exemplare und die unglaubliche Leidenschaft, die dieses Buch bei vielen seiner Leser auslöst, sind daher eher soziologischer als literarischer Natur. Ich dachte immer, der Schlüssel zu diesem Hype liege im kurzen Vorwort des amerikanischen Schriftstellers. Darin stellt er klar, dass sein Roman auf wahren Begebenheiten beruht, darunter der Existenz des Opus Dei (das jeder kennt) und der berühmten Prieuré de Sion, jener Geheimgesellschaft, die angeblich 1099 in Jerusalem gegründet wurde und deren Großmeister Leonardo da Vinci gewesen sein soll. Besser noch: In der Nationalbibliothek hinterlegte „Pergamente“ sollen die Existenz dieser berühmten Prieuré beweisen. Die gesamte Handlung des Romans dreht sich um diese okkulte Bruderschaft, die angeblich ein brisantes Geheimnis bewahrte, das die Kirche seit jeher zu verbergen versucht: die Ehe von Jesus und Maria Magdalena und die zentrale Rolle der Frau in der frühen Kirche. Diese These ist nichts Neues. Doch Dan Brown hat es geschafft, sie aus feministischen und esoterischen Kreisen herauszuholen und sie der breiten Öffentlichkeit in Form eines Mystery-Thrillers anzubieten, der angeblich auf historischen Fakten beruht, die fast jeder kennt. Das Verfahren ist geschickt, aber irreführend. Die Prieuré de Sion wurde 1956 von Pierre Plantard gegründet, einem antisemitischen Mythomane, der sich für einen Nachkommen der merowingischen Könige hielt. Bei den berühmten „Pergamenten“, die in der Nationalbibliothek hinterlegt sind, handelt es sich in Wirklichkeit um vulgäre, maschinengeschriebene Blätter, die Ende der 1960er Jahre von ebendieser Person und seinen Gefolgsleuten verfasst wurden. Tatsache ist, dass „Sakrileg“ für Millionen von Lesern und vielleicht bald auch Zuschauern eine wahre Offenbarung darstellt: die Offenbarung der zentralen Rolle der Frau im frühen Christentum und der Verschwörung der Kirche im 4. Jahrhundert, um die Macht des Mannes wiederherzustellen. So abscheulich Verschwörungstheorien auch sein mögen – man denke nur an die berühmten Protokolle der Weisen von Zion –, so wirken sie leider immer noch gut in den Köpfen einer Öffentlichkeit, die offiziellen Institutionen, religiösen wie akademischen, zunehmend misstrauisch gegenübersteht. Doch so falsch ihre historische Begründung und so fragwürdig ihre konspirative Verpackung auch sein mag, die These vom Machismo der Kirche ist umso verführerischer, als sie auf einer unbestreitbaren Beobachtung beruht: In der katholischen Institution haben nur Männer Macht, und seit Paulus und Augustinus wird Sexualität abgewertet. Es ist daher verständlich, dass sich viele Christen, meist religiös entsozialisiert, von Dan Browns ikonoklastischer These verführen ließen und sich auf die Suche nach dem Gral der Neuzeit begeben: der Wiederentdeckung Maria Magdalenas und des rechtmäßigen Platzes von Sexualität und Weiblichkeit in der christlichen Religion. Ist es nicht eine schöne Suche, wenn man den Brownschen Unsinn einmal beiseite lässt? Le Monde des religions, Mai-Juni 2006. [...]
Le Monde des Religions, März-April 2006 — Darf man über Religionen lachen? Bei Le Monde des Religions, wo wir ständig mit dieser Frage konfrontiert werden, antworten wir hundertmal ja. Religiöse Überzeugungen und Verhaltensweisen stehen nicht über Humor, Gelächter und kritische Karikaturen, und deshalb haben wir uns von Anfang an ohne zu zögern entschieden, humorvolle Karikaturen in diese Zeitschrift aufzunehmen. Es gibt Schutzmechanismen, um die schwerwiegendsten Exzesse einzudämmen: Gesetze, die Rassismus und Antisemitismus verurteilen, Aufstachelung zum Hass, Verleumdung von Personen. Ist es daher angemessen, etwas zu veröffentlichen, das nicht unter das Gesetz fällt? Ich glaube nicht. Wir haben uns immer geweigert, eine dumme und gemeine Karikatur zu veröffentlichen, die keine zum Nachdenken anregende Botschaft vermittelt, sondern nur darauf abzielt, einen religiösen Glauben grundlos zu verletzen oder zu verzerren, oder die alle Anhänger einer Religion verwirrt, beispielsweise durch die Figur ihres Gründers oder ihr emblematisches Symbol. Wir haben Karikaturen veröffentlicht, die pädophile Priester anprangern, aber keine, die Jesus als pädophilen Täter darstellen. Die Botschaft wäre gewesen: Alle Christen sind potenzielle Pädophile. Ebenso haben wir fanatische Imame und Rabbiner karikiert, aber wir werden niemals eine Karikatur veröffentlichen, die Mohammed als Bombenleger oder Moses als Mörder palästinensischer Kinder zeigt. Wir weigern uns zu behaupten, alle Muslime seien Terroristen oder alle Juden Mörder unschuldiger Menschen. Ich möchte hinzufügen, dass ein Zeitungsredakteur aktuelle Themen nicht ignorieren kann. Seine moralische und politische Verantwortung geht über den demokratischen Rechtsrahmen hinaus. Verantwortung bedeutet nicht nur, die Gesetze zu respektieren. Es bedeutet auch, Verständnis und politisches Bewusstsein zu zeigen. Die Veröffentlichung islamfeindlicher Karikaturen im gegenwärtigen Kontext schürt unnötig Spannungen und liefert Extremisten aller Couleur Nahrung. Natürlich sind gewaltsame Repressalien inakzeptabel. Sie zeichnen ein viel karikaturhafteres Bild des Islam als die anstößigen Karikaturen, und viele Muslime sind darüber bestürzt. Gewiss können wir es nicht länger hinnehmen, uns den Regeln einer Kultur zu unterwerfen, die jegliche Kritik an der Religion verbietet. Gewiss können wir die Gewalt der antisemitischen Karikaturen, die in den meisten arabischen Ländern fast täglich veröffentlicht werden, weder vergessen noch tolerieren. Doch all diese Gründe dürfen nicht als Entschuldigung für eine provokative, aggressive oder verächtliche Haltung dienen: Das hieße, die humanistischen Werte – ob religiös oder säkular – zu missachten, die die Grundlage der Zivilisation bilden, die wir stolz vertreten. Was wäre, wenn die wahre Kluft nicht, anders als uns weisgemacht wird, zwischen dem Westen und der muslimischen Welt läge, sondern zwischen jenen in beiden Welten, die Konfrontation suchen und die Wogen glätten, oder im Gegenteil zwischen jenen, die, ohne kulturelle Unterschiede zu leugnen oder zu bagatellisieren, einen kritischen und respektvollen, das heißt konstruktiven und verantwortungsvollen Dialog anstreben? Le Monde des religions, März-April 2006. [...]
Le Monde des Religions, Januar-Februar 2006 — Genau vor einem Jahr, im Januar 2005, erschien das neue Format von Le Monde des Religions. Dies ist für mich eine Gelegenheit, mit Ihnen über die redaktionelle und kommerzielle Entwicklung der Zeitung zu sprechen. Das neue Format hat sich bewährt, denn unsere Zeitung verzeichnet ein starkes Wachstum. Die durchschnittliche Auflage der Zeitschrift lag im Jahr 2004 (altes Format) bei 38.000 Exemplaren pro Ausgabe. Im Jahr 2005 waren es 55.000 Exemplare, ein Anstieg von 45 %. Ende 2004 hatten Sie 25.000 Abonnenten, heute sind es 30.000. Vor allem die Kioskverkäufe haben einen spektakulären Sprung gemacht: von durchschnittlich 13.000 Exemplaren pro Ausgabe im Jahr 2004 auf 25.000 Exemplare im Jahr 2005. Angesichts des mehr als düsteren Klimas in der französischen Presse – die meisten Titel sind rückläufig – ist ein solcher Anstieg außergewöhnlich. Ich danke daher allen unseren Abonnenten und treuen Lesern, die zum Erfolg von Le Monde des Religions beigetragen haben, herzlich. Wir dürfen uns jedoch nicht zu schnell als Sieger verkünden, denn wir befinden uns noch an der Schwelle zur Rentabilität, die bei über 60.000 Exemplaren liegt. Wir zählen daher weiterhin auf Ihre Treue und Ihren Wunsch, Le Monde des Religions in Ihrem Umfeld bekannt zu machen, um die Langlebigkeit des Titels zu sichern. Viele von Ihnen haben uns geschrieben, um uns zu ermutigen oder ihre Kritik mitzuteilen, und dafür danke ich Ihnen herzlich. Ich habe einige Ihrer Kommentare berücksichtigt, um Ihre Zeitschrift weiterzuentwickeln. Sie werden in dieser Ausgabe feststellen, dass die Rubrik „Nachrichten“ entfernt wurde. Unser zweimonatlicher Erscheinungstermin und die sehr frühen Ausgabeschlusstermine (etwa einen Monat vor Erscheinen) erlauben es uns nicht, mit dem aktuellen Geschehen Schritt zu halten. Wir haben daher die mit dem neuen Format begonnene Logik weiterverfolgt und die „Nachrichten“-Seiten durch einen großen sechsseitigen Artikel ersetzt, der am Anfang der Zeitung, direkt nach dem Leitartikel, erscheint und entweder einen historischen Bericht oder eine soziologische Untersuchung enthält. Damit tragen wir dem Wunsch vieler Leser nach längeren und ausführlicheren Artikeln Rechnung. Auf diesen großen Artikel folgt ein „Forum“, ein interaktiver Bereich in der Zeitung, der noch mehr Raum für Leserbriefe, Fragen an Odon Vallet, Reaktionen und Kolumnen von Persönlichkeiten sowie Cartoons verschiedener Autoren (Chabert und Valdor brauchen eine Verschnaufpause) bietet. Das große Interview findet sich daher am Ende der Zeitschrift. Ich nutze diesen ersten Jahrestag auch, um all jenen zu danken, die für die Entwicklung von Le Monde des Religions gekämpft haben, angefangen bei Jean-Marie Colombani, ohne den es diese Zeitschrift nicht gäbe und der uns stets seine Unterstützung und sein Vertrauen geschenkt hat. Vielen Dank auch an die Teams von Malesherbes Publications und seine jeweiligen Direktoren, die uns bei unserem Fortschritt geholfen und unterstützt haben, sowie an die Vertriebsteams von Le Monde, die erfolgreich in Werbung und Kioskverkauf investiert haben. Und schließlich danke ich dem kleinen Team von Le Monde des Religions sowie den damit verbundenen Kolumnisten und freien Journalisten, die mit Begeisterung daran arbeiten, Ihnen ein besseres Verständnis der Religionen und der Weisheit der Menschheit zu vermitteln. [...]
Le Monde des religions, November-Dezember 2005 – Auch wenn ich in diesen Kolumnen nur ungern über ein Werk spreche, dessen Mitautor ich bin, kann ich es mir nicht verkneifen, Abbé Pierres neuestes Buch zu verschweigen, das brennende Themen von aktuellem Interesse berührt und die Gefahr birgt, viele Leidenschaften zu wecken. *Fast ein Jahr lang habe ich die Überlegungen und Fragen des Emmaüs-Gründers zu sehr unterschiedlichen Themen gesammelt – vom religiösen Fanatismus bis zum Problem des Bösen, über die Eucharistie oder die Erbsünde. Fünf der 28 Kapitel sind Fragen der Sexualmoral gewidmet. Angesichts der Strenge von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. in dieser Frage erscheinen Abbé Pierres Bemerkungen revolutionär. Liest man jedoch aufmerksam, bleibt der Emmaüs-Gründer recht gemäßigt. Er spricht sich für die Ordination verheirateter Männer aus, bekräftigt aber nachdrücklich die Notwendigkeit der Beibehaltung des geweihten Zölibats. Er verurteilt die Verbindung von Personen gleichen Geschlechts nicht, wünscht sich aber, dass die Ehe eine den Heterosexuellen vorbehaltene soziale Institution bleibt. Er glaubt, dass Jesus, da er ganz Mensch ist, zwangsläufig die Kraft des sexuellen Verlangens empfand, betont aber auch, dass nichts im Evangelium uns erlaubt zu bestätigen, ob er diesem Verlangen nachgab oder nicht. Schließlich erinnert er in einem etwas anderen, aber ebenso heiklen Bereich daran, dass es kein entscheidendes theologisches Argument gegen die Ordination von Frauen zu geben scheint und dass diese Frage vor allem eine Frage der Entwicklung von Mentalitäten ist, die bis heute von einer gewissen Verachtung des „schwachen Geschlechts“ geprägt sind. Wenn Abbé Pierres Worte innerhalb der katholischen Kirche sicherlich für Aufsehen sorgen werden, dann nicht, weil sie den moralischen Relativismus unserer Zeit zu entkräften versuchen (was ein sehr schwerwiegender Vorwurf wäre), sondern weil sie eine Diskussion über die Frage der Sexualität eröffnen, die wahrhaft tabu geworden ist. Und gerade weil diese Debatte von Rom eingefroren wurde, sind die Bemerkungen und Fragen von Abbé Pierre für einige entscheidend, für andere beunruhigend. Ich war vor der Veröffentlichung des Buches bei dieser Debatte innerhalb von Emmaus selbst dabei, als Abbé Pierre das Manuskript seinem Umfeld zum Lesen gab. Einige reagierten begeistert, andere unbehaglich und kritisch. Ich möchte hier auch den verschiedenen Verantwortlichen von Emmaus meine Anerkennung aussprechen, die, unabhängig von ihrer Meinung, die Entscheidung ihres Gründers, dieses Buch so zu veröffentlichen, wie es war, respektierten. Einem von ihnen, der sich über den großen Raum, der Fragen der Sexualität in dem Werk eingeräumt wurde – und noch mehr über die Art und Weise, wie die Medien darüber berichten würden –, Sorgen machte, wies Abbé Pierre darauf hin, dass diese Fragen der Sexualmoral in den Evangelien letztlich nur einen sehr geringen Platz einnehmen. Aber gerade weil die Kirche diesen Fragen große Bedeutung beimaß, fühlte er sich verpflichtet, darüber zu sprechen. Viele Christen und Nichtchristen waren schockiert über die unnachgiebigen Positionen des Vatikans zu Themen, die nichts mit den Grundlagen des Glaubens zu tun hatten und eine echte Debatte verdienten. Ich stimme dem Standpunkt des Emmaus-Gründers voll und ganz zu. Ich möchte hinzufügen: Wenn die Evangelien – denen wir unser Dossier widmen – diese Fragen nicht aufgreifen, dann deshalb, weil sie nicht in erster Linie eine individuelle oder kollektive Moral begründen wollen, sondern das Herz eines jeden Menschen für einen Abgrund öffnen wollen, der sein Leben erschüttern und neu ausrichten kann. Ist die Kirche nicht für viele unserer Zeitgenossen zu einem echten Hindernis für die Entdeckung der Person und Botschaft Christi geworden, indem sie sich zu sehr auf Dogmen und Normen konzentriert und dabei die Botschaft Jesu, die lautete: „Seid barmherzig“ und „Richtet nicht“, vernachlässigt? Niemand könnte sich heute zweifellos besser darum kümmern als Abbé Pierre, der seit siebzig Jahren einer der besten Zeugen der Botschaft des Evangeliums ist. *Abbé Pierre, mit Frédéric Lenoir, „Mein Gott ... Warum?“ Kleine Meditationen über den christlichen Glauben und den Sinn des Lebens, Plön, 27. Oktober 2005. [...]
Le Monde des religions, September-Oktober 2005 – „Warum das 21. Jahrhundert religiös ist.“ Der Titel des Leitartikels dieser Ausgabe zum Schulanfang greift den berühmten Satz von André Malraux auf: „Das 21. Jahrhundert wird religiös sein oder nicht.“ Dieser Satz trifft den Nagel auf den Kopf. Seit zwanzig Jahren wird er von allen Medien wieder aufgewärmt und manchmal auch so umgeschrieben: „Das 21. Jahrhundert wird spirituell sein oder nicht.“ Ich habe bereits rednerische Auseinandersetzungen zwischen Anhängern dieser beiden Zitate miterlebt. Ein vergeblicher Kampf … denn Malraux hat diesen Satz nie ausgesprochen! In seinen Büchern, seinen handschriftlichen Notizen, seinen Reden oder Interviews findet sich keine Spur davon. Besser noch: Der Betreffende selbst hat dieses Zitat ständig abgestritten, als man Mitte der 1950er Jahre begann, es ihm zuzuschreiben. Unser Freund und Mitarbeiter Michel Cazenave, neben anderen Zeugen aus Malrauxs Umfeld, hat uns kürzlich erneut daran erinnert. Was also genau sagte der große Schriftsteller, das ihn auf die Idee brachte, eine solche Prophezeiung in den Mund zu legen? Alles scheint sich 1955 im Rahmen zweier Texte entschieden zu haben. Auf eine Frage der dänischen Zeitung Dagliga Nyhiter zu den religiösen Grundlagen der Moral schloss Malraux seine Antwort wie folgt: „Seit fünfzig Jahren integriert die Psychologie Dämonen in den Menschen. So lautet die ernsthafte Einschätzung der Psychoanalyse. Ich denke, die Aufgabe des nächsten Jahrhunderts, angesichts der schrecklichsten Bedrohung, die die Menschheit je erlebt hat, wird darin bestehen, die Götter wieder einzuführen.“ Im März desselben Jahres veröffentlichte die Zeitschrift Preuves zwei Neuauflagen von Interviews aus den Jahren 1945 und 1946, ergänzt durch einen Fragebogen an den Autor von Vita activa. Am Ende dieses Interviews erklärte Malraux: „Das entscheidende Problem des ausgehenden Jahrhunderts wird das religiöse Problem sein – in einer Form, die sich von der uns bekannten so sehr unterscheidet, wie sich das Christentum von den antiken Religionen unterschied.“ » Aus diesen beiden Zitaten wurde die berühmte Formel konstruiert – ohne dass jemand weiß, von wem. Diese ist jedoch höchst zweideutig. Denn die „Rückkehr der Religion“, die wir erleben, insbesondere in ihrer identitären und fundamentalistischen Form, ist das Gegenteil der Religion, auf die General de Gaulles ehemaliger Kulturminister anspielt. Das zweite Zitat ist in dieser Hinsicht äußerst eindeutig: Malraux kündigt das Aufkommen einer religiösen Problematik an, die sich radikal von denen der Vergangenheit unterscheidet. In zahlreichen anderen Texten und Interviews ruft er, in der Art von Bergsons „Seelenergänzung“, zu einem großen spirituellen Ereignis auf, das den Menschen aus dem Abgrund heben soll, in den er sich im 20. Jahrhundert gestürzt hat (siehe zu diesem Thema das schöne Büchlein von Claude Tannery, L’Héritage spirituel de Malraux – Arléa, 2005). Für Malraux’ Agnostiker stellte dieses spirituelle Ereignis keinen Aufruf zur Wiederbelebung der traditionellen Religionen dar. Malraux hielt Religionen für ebenso sterblich wie Valéry Zivilisationen. Doch erfüllten sie für ihn eine grundlegende positive Funktion, die auch weiterhin erfüllt sein wird: die Schaffung von Göttern, „die Fackeln, die der Mensch nach und nach entzündet, um ihm den Weg zu erleuchten, der ihn vom Tier losreißt“. Wenn Malraux behauptet, „die Aufgabe des 21. Jahrhunderts wird darin bestehen, die Götter wieder in den Menschen einzuführen“, ruft er damit zu einer neuen Welle der Religiosität auf, die jedoch aus den Tiefen des menschlichen Geistes kommen und sich in Richtung einer bewussten Integration des Göttlichen in die Psyche bewegen wird – wie die Dämonen der Psychoanalyse – und nicht in eine Projektion des Göttlichen nach außen, wie es bei traditionellen Religionen oft der Fall war. Mit anderen Worten: Malraux wartete auf das Aufkommen einer neuen Spiritualität in den Farben des Menschen, einer Spiritualität, die sich vielleicht noch im Entstehen befindet, aber zu Beginn dieses Jahrhunderts noch stark durch den heftigen Zusammenprall traditioneller religiöser Identitäten erstickt wird. PS 1: Ich freue mich über die Ernennung von Djénane Kareh Tager zur Chefredakteurin von Le Monde des Religions (bisher war sie Generalsekretärin der Redaktion). PS 2: Ich möchte unsere Leser über die Veröffentlichung einer neuen, sehr lehrreichen Sonderausgabe von Le Monde des Religions informieren: „20 Schlüssel zum Verständnis“. Die erste Ausgabe befasst sich mit den Religionen des alten Ägypten (siehe Seite 7).
[...]
Le Monde des religions, Juli-August 2005. Harry Potter, The Da Vinci Code, Der Herr der Ringe, Der Alchimist: Die größten literarischen und filmischen Erfolge des letzten Jahrzehnts haben eines gemeinsam: Sie befriedigen unser Verlangen nach dem Wunderbaren. Gespickt mit heiligen Rätseln, Zauberformeln, seltsamen Phänomenen und schrecklichen Geheimnissen befriedigen sie unsere Lust am Mysteriösen, unsere Faszination für das Unerklärliche. Denn das ist das Paradox unserer Ultramoderne: Je weiter die Wissenschaft voranschreitet, desto mehr brauchen wir Träume und Mythen. Je entzifferbarer und rationalisierbarer die Welt erscheint, desto mehr versuchen wir, ihre magische Aura wiederherzustellen. Wir erleben derzeit einen Versuch, die Welt wieder zu verzaubern … gerade weil sie entzaubert wurde. Carl Gustav Jung erklärte dies vor einem halben Jahrhundert: Der Mensch braucht Vernunft ebenso wie Emotionen, Wissenschaft ebenso wie Mythen, Argumente ebenso wie Symbole. Warum? Ganz einfach, weil er nicht nur ein vernunftbegabtes Wesen ist. Er verbindet sich mit der Welt auch durch seine Sehnsucht, seine Sensibilität, sein Herz, seine Vorstellungskraft. Er nährt sich von Träumen ebenso wie von logischen Erklärungen, von Poesie und Legenden ebenso wie von objektivem Wissen. Der Irrtum des europäischen Szientismus, ein Erbe des 19. Jahrhunderts (mehr als der Aufklärung), bestand darin, dies zu leugnen. Wir glaubten, den irrationalen Teil des Menschen ausmerzen und alles gemäß der kartesianischen Logik erklären zu können. Wir verachteten Vorstellungskraft und Intuition. Wir degradierten Mythen in den Rang von Kinderfabeln. Die christlichen Kirchen folgten teilweise den Spuren der rationalistischen Kritik. Sie bevorzugten einen dogmatischen und normativen Diskurs – der an die Vernunft appellierte – auf Kosten der Vermittlung einer inneren – mit dem Herzen verbundenen – Erfahrung oder eines symbolischen Wissens, das die Vorstellungskraft anspricht. Wir erleben heute daher eine Rückkehr des Verdrängten. Dan Browns Leser sind im Wesentlichen Christen, die in seinen esoterischen Thrillern das Element des Mysteriums, des Mythos und der Symbolik suchen, das sie in ihren Kirchen nicht mehr finden. Fans des Herrn der Ringe, wie auch treue Leser von Bernard Werber, sind oft junge Erwachsene mit einem guten naturwissenschaftlichen und technischen Hintergrund, die aber auch auf der Suche nach magischen Welten sind, die von anderen Mythologien inspiriert sind als denen unserer Religionen, von denen sie sich stark distanziert haben. Sollte uns diese Rückkehr des Mythos und des Wunderbaren beunruhigen? Sicherlich nicht, solange sie nicht wiederum eine Ablehnung von Vernunft und Wissenschaft darstellt. Religionen sollten beispielsweise diesem Bedürfnis nach Emotion, Mysterium und Symbolik mehr Bedeutung beimessen, ohne auf die Tiefe moralischer und theologischer Lehren zu verzichten. Leser des Da Vinci Codes können sich von der Magie des Romans und der großen Mythen der Esoterik (das Geheimnis der Templer usw.) berühren lassen, ohne die Thesen des Autors für bare Münze zu nehmen und historisches Wissen im Namen einer frei erfundenen Verschwörungstheorie zu widerlegen. Mit anderen Worten: Es geht um das richtige Gleichgewicht zwischen Wunsch und Realität, Emotion und Vernunft. Der Mensch braucht das Wunderbare, um ganz Mensch zu sein, aber er darf seine Träume nicht mit der Realität verwechseln. Le Monde des religions, Juli-August 2005. [...]
Le Monde des religions, Mai-Juni 2005 – Karol Wojtyla, Denker, Mystiker und Papst mit außergewöhnlichem Charisma, hinterlässt seinem Nachfolger dennoch ein zwiespältiges Erbe. Johannes Paul II. riss viele Mauern nieder, errichtete aber auch neue. Dieses lange, paradoxe Pontifikat der Offenheit, insbesondere gegenüber anderen Religionen, und der doktrinellen und disziplinären Abschottung wird in jedem Fall eines der wichtigsten Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche und zweifellos der gesamten Geschichte markieren. Während ich diese Zeilen schreibe, bereiten sich die Kardinäle auf die Wahl des Nachfolgers von Johannes Paul II. vor. Wer auch immer der neue Papst sein wird, er wird mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein. Dies sind die wichtigsten Fragen für die Zukunft des Katholizismus, denen wir in einem Sonderbericht nachgehen. Ich werde nicht auf die Analysen und die zahlreichen Punkte eingehen, die in diesen Seiten von Régis Debray, Jean Mouttapa, Henri Tincq, François Thual und Odon Vallet angesprochen wurden, noch auf die Bemerkungen verschiedener Vertreter anderer Religionen und christlicher Konfessionen. Ich möchte nur auf einen Aspekt aufmerksam machen. Eine der größten Herausforderungen für den Katholizismus wie für jede andere Religion besteht darin, die spirituellen Bedürfnisse unserer Zeitgenossen zu berücksichtigen. Diese Bedürfnisse äußern sich heute jedoch auf drei Arten, die wenig mit der katholischen Tradition vereinbar sind, was die Aufgabe der Nachfolger von Johannes Paul II. äußerst schwierig machen wird. Tatsächlich erleben wir seit der Renaissance eine doppelte Bewegung der Individualisierung und Globalisierung, die sich in den letzten dreißig Jahren immer weiter beschleunigt hat. Die Folge auf religiöser Ebene: Der Einzelne neigt dazu, seine persönliche Spiritualität aus dem globalen Reservoir an Symbolen, Praktiken und Lehren zu konstruieren. Ein Westler kann sich heute problemlos als Katholik bezeichnen, sich von der Person Jesu berühren lassen, ab und zu zur Messe gehen, aber auch Zen-Meditation praktizieren, an Reinkarnation glauben und Sufi-Mystiker lesen. Dasselbe gilt für einen Südamerikaner, einen Asiaten oder einen Afrikaner, die sich ebenfalls – und das schon seit langem – von einem religiösen Synkretismus zwischen Katholizismus und traditionellen Religionen angezogen fühlen. Diese „symbolische Bricolage“, diese Praxis des „religiösen Abseitss“, breitet sich immer weiter aus, und es ist schwer vorstellbar, wie die katholische Kirche ihren Gläubigen die strikte Einhaltung des Dogmas und der Praxis aufzwingen kann, an denen sie so sehr hängt. Eine weitere enorme Herausforderung: die Rückkehr des Irrationalen und des magischen Denkens. Der Rationalisierungsprozess, der im Westen seit langem im Gange ist und das Christentum tief durchdrungen hat, führt heute zu einer Gegenreaktion: der Unterdrückung des Imaginären und des magischen Denkens. Doch wie Régis Debray hier erinnert: Je technischer und rationalisierter die Welt wird, desto mehr offenbart sie im Gegenzug ein Verlangen nach dem Affektiven, Emotionalen, Imaginären und Mythischen. Daher der Erfolg von Esoterik, Astrologie, Paranormalem und die Entwicklung magischer Verhaltensweisen innerhalb der historischen Religionen selbst – wie etwa die Wiederbelebung des Heiligenkults im Katholizismus und im Islam. Zu diesen beiden Trends kommt ein Phänomen, das die traditionelle Sichtweise des Katholizismus erschüttert: Unsere Zeitgenossen interessieren sich viel weniger für das Glück im Jenseits als für das irdische Glück. Die gesamte christliche Pastoral verändert sich dadurch: Wir predigen nicht mehr Himmel und Hölle, sondern das Glück, sich jetzt erlöst zu fühlen, weil wir Jesus in emotionaler Gemeinschaft begegnet sind. Ganze Teile des Lehramtes bleiben mit dieser Entwicklung hinterher, die Sinn und Affekt über die treue Einhaltung von Dogmen und Normen stellt. Synkretistische und magische Praktiken, die auf irdisches Glück abzielten: Das war es, was das Heidentum der Antike kennzeichnete, das Erbe der Religionen der Vorgeschichte (siehe unser Dossier), gegen das sich die Kirche so hartnäckig durchzusetzen versuchte. Das Archaische erlebt in der Ultramoderne ein starkes Comeback. Dies ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, der sich das Christentum im 21. Jahrhundert stellen muss. [...]
Le Monde des religions, März-April 2005 — Es spielt keine Rolle, ob der Teufel existiert oder nicht. Unbestreitbar ist seine Rückkehr. In Frankreich und auf der ganzen Welt. Nicht auf spektakuläre und sensationelle Weise, sondern auf diffuse und vielschichtige Weise. Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen auf diese überraschende Rückkehr. Die Schändungen von Friedhöfen, häufiger satanischer als rassistischer Natur, haben im letzten Jahrzehnt weltweit zugenommen. In Frankreich wurden in den letzten fünf Jahren über 3.000 jüdische, christliche oder muslimische Gräber geschändet, doppelt so viele wie im Jahrzehnt davor. Während nur 18 % der Franzosen an die Existenz des Teufels glauben, teilen die unter 24-Jährigen diesen Glauben am häufigsten (27 %). Und 34 % glauben, dass ein Mensch vom Teufel besessen sein kann (1). Der Glaube an die Hölle hat sich unter den unter 28-Jährigen in den letzten zwei Jahrzehnten sogar verdoppelt (2). Unsere Umfrage zeigt, dass bedeutende Teile der Jugendkultur – Gothic und Metal – von Verweisen auf Satan durchdrungen sind, den Inbegriff des rebellischen Satans, der sich dem Vater widersetzte. Sollten wir dieses morbide und manchmal gewalttätige Universum einfach als normale Manifestation eines Bedürfnisses nach Rebellion und Provokation verstehen? Oder sollten wir es einfach mit der zunehmenden Verbreitung von Filmen, Comics und Videospielen erklären, in denen der Teufel und seine Anhänger vorkommen? In den 60er und 70er Jahren versuchten Jugendliche – und ich war einer von ihnen –, ihre Andersartigkeit und Rebellion auszudrücken, indem sie die Konsumgesellschaft ablehnten. Indische Gurus und die mitreißende Musik von Pink Floyd faszinierten uns mehr als Beelzebub und hyperbrutaler Heavy Metal. Sollten wir in dieser Faszination für das Böse nicht ein Spiegelbild der Gewalt und der Ängste unserer Zeit sehen, die geprägt ist vom Zerfall traditioneller sozialer Bezüge und Bindungen und von tiefer Zukunftsangst? Wie Jean Delumeau uns in Erinnerung ruft, zeigt die Geschichte, dass der Teufel gerade in Zeiten großer Angst auf die Bühne zurückkehrt. Ist dies nicht auch der Grund für Satans Rückkehr in die Politik? Ayatollah Khomeini hatte den Teufel wieder eingeführt, als er den großen amerikanischen Satan geißelte. Ronald Reagan, Bin Laden und George Bush griffen den Bezug zum Teufel und die explizite Dämonisierung des politischen Gegners auf. Letzterer ist nur inspiriert von der wiedererstarkten Popularität Satans unter amerikanischen Evangelikalen, die zunehmend Exorzismus praktizieren und eine den Mächten des Bösen unterworfene Welt anprangern. Seit Paul VI., der angesichts der zunehmenden Säkularisierung der westlichen Länder vom „Rauch Satans“ sprach, ist die katholische Kirche, die sich längst vom Teufel distanziert hatte, nicht zurückgeblieben. Als Zeichen der Zeit hat der Vatikan kürzlich ein Exorzismus-Seminar an der renommierten Päpstlichen Universität Regina Apostolorum eingerichtet. All diese Hinweise rechtfertigten nicht nur eine regelrechte Untersuchung der Rückkehr des Teufels, sondern auch seiner Identität und seiner Rolle. Wer ist der Teufel? Wie erschien er in den Religionen? Was sagen Bibel und Koran über ihn? Warum brauchen monotheistische Religionen diese Figur, die das absolute Böse verkörpert, mehr als schamanische, polytheistische oder asiatische Religionen? Wie kann die Psychoanalyse auch Licht auf diese Figur, auf ihre psychische Funktion werfen und eine anregende symbolische Neuinterpretation des biblischen Teufels ermöglichen? Denn während das „Symbol“ – sumbolon – seiner Etymologie zufolge „das ist, was verbindet“, ist der „Teufel“ – diabolon – „das, was trennt“. Eines scheint mir sicher: Nur wenn wir unsere Ängste und unsere „Spaltungen“, sowohl individuelle als auch kollektive, identifizieren, sie durch eine anspruchsvolle Bewusstseins- und Symbolisierungsarbeit ans Licht bringen, indem wir unsere dunkle Seite integrieren – wie Juliette Binoche uns in dem erhellenden Interview, das sie uns gewährt hat, in Erinnerung ruft –, werden wir den Teufel und dieses archaische, so alte Bedürfnis wie die Menschheit überwinden, unsere eigenen ungezähmten Impulse und unsere Ängste vor der Zersplitterung auf das Andere, das Andere, das Fremde zu projizieren. (1) Laut einer Umfrage der Zeitschrift Sofres/Pèlerin vom Dezember 2002. (2) Die Werte der Europäer, Futuribles, Juli-August 2002)
[...]
Le Monde des religions, Januar-Februar 2005 — Leitartikel — Als ich Ende der 1980er Jahre meine Tätigkeit im Verlags- und Pressewesen aufnahm, interessierte sich niemand für Religion. Heute erobert sie in vielfältiger Form die Medien. Tatsächlich beginnt das 21. Jahrhundert mit einem zunehmenden Einfluss „religiöser Fakten“ auf die Welt und die Gesellschaften. Warum? Wir sind heute mit zwei sehr unterschiedlichen Ausdrucksformen von Religion konfrontiert: dem Erwachen der Identität und dem Bedürfnis nach Sinn. Das Erwachen der Identität betrifft den gesamten Planeten. Es entsteht aus dem Zusammenprall der Kulturen, aus neuen politischen und wirtschaftlichen Konflikten, die Religion zum Symbol der Identität eines Volkes, einer Nation oder einer Zivilisation machen. Das Bedürfnis nach Sinn betrifft vor allem den säkularisierten und entideologisierten Westen. Ultramoderne Menschen misstrauen religiösen Institutionen, sie wollen ihr Leben selbst bestimmen, sie glauben nicht mehr an die strahlende Zukunft, die Wissenschaft und Politik versprechen: Dennoch sind sie weiterhin mit den großen Fragen nach Ursprung, Leid und Tod konfrontiert. Ebenso brauchen sie Riten, Mythen und Symbole. Dieses Bedürfnis nach Sinn hinterfragt die großen philosophischen und religiösen Traditionen der Menschheit neu: den Erfolg des Buddhismus und der Mystik, die Wiederbelebung der Esoterik, die Rückkehr zur griechischen Weisheit. Das Erwachen der Religion in ihren beiden Aspekten – Identität und Spiritualität – erinnert an die doppelte Etymologie des Wortes Religion: sich versammeln und verbinden. Der Mensch ist ein religiöses Wesen, weil er zum Himmel blickt und das Rätsel der Existenz hinterfragt. Er versammelt sich, um das Heilige willkommen zu heißen. Er ist auch religiös, weil er versucht, sich mit seinen Mitmenschen in einem heiligen, auf Transzendenz basierenden Band zu verbinden. Diese duale vertikale und horizontale Dimension der Religion existiert seit Anbeginn der Zeit. Religion war einer der wichtigsten Katalysatoren für die Entstehung und Entwicklung von Zivilisationen. Sie hat Erhabenes hervorgebracht: das aktive Mitgefühl von Heiligen und Mystikern, wohltätige Werke, die größten künstlerischen Meisterwerke, universelle moralische Werte und sogar die Geburt der Wissenschaft. Doch in seiner harten Form hat er schon immer Kriege und Massaker geschürt und legitimiert. Auch der religiöse Extremismus hat seine zwei Seiten. Das Gift der vertikalen Dimension ist dogmatischer Fanatismus oder wahnhafte Irrationalität. Eine Art Pathologie der Gewissheit, die Einzelne und Gesellschaften im Namen des Glaubens in alle Extreme treiben kann. Das Gift der horizontalen Dimension ist rassistischer Kommunitarismus, eine Pathologie der kollektiven Identität. Die explosive Mischung aus beidem führte zu Hexenjagden, der Inquisition, der Ermordung Jitzchak Rabins und den Anschlägen des 11. September. Angesichts der Bedrohungen, die sie für den Planeten darstellen, sind einige europäische Beobachter und Intellektuelle versucht, Religion auf ihre extremistischen Formen zu reduzieren und sie pauschal zu verurteilen (z. B. Islam = radikaler Islamismus). Das ist ein schwerer Fehler, der das, was wir bekämpfen wollen, nur noch verstärkt. Wir werden den religiösen Extremismus nur besiegen können, wenn wir auch den positiven und zivilisierenden Wert der Religionen anerkennen und ihre Vielfalt akzeptieren. Indem wir anerkennen, dass der Mensch ein individuelles und kollektives Bedürfnis nach dem Heiligen und nach Symbolen hat; indem wir die Wurzeln der Übel angreifen, die den gegenwärtigen Erfolg der Instrumentalisierung der Religion durch die Politik erklären: Nord-Süd-Ungleichheit, Armut und Ungerechtigkeit, der neue amerikanische Imperialismus, eine zu schnelle Globalisierung, die Verachtung traditioneller Identitäten und Bräuche … Das 21. Jahrhundert wird das sein, was wir daraus machen. Religion kann ebenso ein symbolisches Werkzeug im Dienste einer Eroberungs- und Zerstörungspolitik sein wie ein Ferment individueller Entfaltung und des Weltfriedens in der Vielfalt der Kulturen. [...]
Le Monde des Religions, November-Dezember 2004 — Leitartikel — Seit einigen Jahren erleben wir eine Rückkehr religiöser Gewissheiten, verbunden mit einer wachsenden Identitätskrise, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht. Ich glaube, das ist der Wald vor lauter Bäumen. Was den Westen betrifft, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, wie weit wir in einem Jahrhundert gekommen sind. Die Ausgabe, die wir dem 100. Jahrestag des französischen Gesetzes zur Trennung von Kirche und Staat widmen, gibt mir die Gelegenheit, diesen unglaublichen Kontext des Hasses und der gegenseitigen Ausgrenzung zwischen dem papistischen und dem antiklerikalen Lager erneut zu beleuchten. In Europa war die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine Zeit der Gewissheiten. Ideologischer, religiöser und wissenschaftlicher Gewissheiten. Viele Christen waren überzeugt, dass ungetaufte Kinder in die Hölle kommen und dass nur ihre Kirche die Wahrheit besitzt. Atheisten hingegen verachteten die Religion und betrachteten sie als anthropologische (Feuerbach), intellektuelle (Comte), ökonomische (Marx) oder psychologische (Freud) Entfremdung. Heute glauben laut einer aktuellen Umfrage 90 % der Gläubigen in Europa und den Vereinigten Staaten, dass keine einzelne Religion die Wahrheit besitzt, sondern dass alle Religionen Wahrheiten enthalten. Auch Atheisten sind toleranter geworden, und die meisten Wissenschaftler betrachten Religion nicht mehr als Aberglauben, der mit dem Fortschritt der Wissenschaft verschwinden wird. Insgesamt haben wir uns in kaum einem Jahrhundert von einem geschlossenen Universum der Gewissheiten in eine offene Welt der Wahrscheinlichkeiten bewegt. Diese moderne Form des Skeptizismus, die François Furet als „unüberwindbaren Horizont der Moderne“ bezeichnete, konnte sich in unseren Gesellschaften verbreiten, weil sich die Gläubigen anderen Religionen geöffnet haben, aber auch, weil sich die Moderne von den Gewissheiten befreit hat, die sie aus dem szientistischen Fortschrittsmythos geerbt hat: Wo das Wissen voranschreitet, treten Religion und traditionelle Werte in den Hintergrund. Sind wir deshalb nicht zu Jüngern Montaignes geworden? Unabhängig von ihren philosophischen oder religiösen Überzeugungen vertritt die Mehrheit der Westler die Ansicht, dass die menschliche Intelligenz nicht in der Lage ist, letzte Wahrheiten und endgültige metaphysische Gewissheiten zu erlangen. Mit anderen Worten: Gott ist ungewiss. Wie unser großer Philosoph vor fünf Jahrhunderten erklärte, kann man daher an Ungewissheit nur glauben, aber auch nicht. Ungewissheit, das möchte ich betonen, bedeutet nicht Zweifel. Wir können Glauben, tiefe Überzeugungen und Gewissheiten haben, aber zugeben, dass andere diese in gutem Glauben und mit ebenso vielen guten Gründen wie wir möglicherweise nicht teilen. Die Interviews, die zwei Theatermänner, Eric-Emmanuel Schmitt und Peter Brook, Le Monde des Religions gaben, sind in dieser Hinsicht beredt. Ersterer glaubt leidenschaftlich an „einen nicht identifizierbaren Gott“, der „nicht aus dem Wissen kommt“, und bekräftigt, dass „ein Gedanke, der nicht an sich selbst zweifelt, nicht intelligent ist“. Der zweite nimmt keinen Bezug auf Gott, sondern bleibt offen für ein „unbekanntes, unbenennbares“ göttliches Wesen und bekennt: „Ich hätte gern gesagt: ‚Ich glaube an nichts…‘ Aber an nichts zu glauben ist immer noch der absolute Ausdruck eines Glaubens.“ Solche Bemerkungen veranschaulichen eine Tatsache, die meiner Meinung nach eine eingehendere Betrachtung verdient, um Stereotypen und vereinfachenden Diskursen zu entgehen: Die wirkliche Kluft besteht heute immer weniger, wie im letzten Jahrhundert, zwischen „Gläubigen“ und „Ungläubigen“, sondern zwischen denen, „Gläubigen“ oder „Ungläubigen“, die die Ungewissheit akzeptieren, und denen, die sie ablehnen. ? Le Monde des Religions, November-Dezember 2004 [...]
Speichern